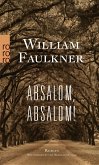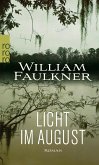Dieser Roman erzählt die Geschichte der Familie Compson über drei Jahrzehnte, beginnend mit Benjy, dem geistig behinderten Sohn des Hauses. Er kennt kein Gestern, Heute und Morgen, ist so auf ewig in der Gegenwart gefangen.
Für Quentin, den Ältesten, bricht 1910 der letzte Tag in Harvard an. Er prüft sein geistiges Erbe, ordnet den spärlichen Nachlass und findet kaum Gründe, die ihn noch ans Leben binden. Und so fällt Jason, dem Jüngsten, die Rolle des Familienvorstands zu - eine Rolle, die er kaum ausfüllen kann.
«Schall und Wahn»: ein ungeheuerlicher Familienroman voller Wut, Eigensinn und auch Humor.
Ein Klassiker der Weltliteratur - neu übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Frank Heibert.
Für Quentin, den Ältesten, bricht 1910 der letzte Tag in Harvard an. Er prüft sein geistiges Erbe, ordnet den spärlichen Nachlass und findet kaum Gründe, die ihn noch ans Leben binden. Und so fällt Jason, dem Jüngsten, die Rolle des Familienvorstands zu - eine Rolle, die er kaum ausfüllen kann.
«Schall und Wahn»: ein ungeheuerlicher Familienroman voller Wut, Eigensinn und auch Humor.
Ein Klassiker der Weltliteratur - neu übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Frank Heibert.
Wenn William Faulkner der amerikanische Joyce ist, dann ist «Schall und Wahn» sein Ulysses ... und Frank Heiberts Neuübersetzung ein echter Quantensprung. Neue Zürcher Zeitung
"Faulkners Meisterwerk." (La Stampa)
"Schall und Wahn katapultierte Faulkner in die erste Reihe der literarischen Moderne." (Neue Zürcher Zeitung)
"Ein modernistischer Meilenstein. Zerstörte Handlungschronologie und figurentypische Sprech- und Denkweise werden mit der Technik des Bewußtseinsstroms, der fließenden Assoziationsfolge unbewußte strukturierter Bilder und Visionen, zu einer multiperspektivischen Famlienchronik montiert. Wohl nur Virginia Woolfs form-inhaltlich ähnlich gestalteter Roman Die Wellen hält den Vergleich mit diesem Prosamonument aus." (Basler Zeitung)
"Gilt als Faulkners Hauptwerk. Auf verschiedenen Handlungs- und Zeitebenen, mit den Mitteln des Bewußtseinsstromes und in mythischen Parallelen erzählt Faulkner die Geschichte vom Niedergang der Großgrundbesitzerfamilie Compson." (Norddeutscher Rundfunk)
"Schall und Wahn katapultierte Faulkner in die erste Reihe der literarischen Moderne." (Neue Zürcher Zeitung)
"Ein modernistischer Meilenstein. Zerstörte Handlungschronologie und figurentypische Sprech- und Denkweise werden mit der Technik des Bewußtseinsstroms, der fließenden Assoziationsfolge unbewußte strukturierter Bilder und Visionen, zu einer multiperspektivischen Famlienchronik montiert. Wohl nur Virginia Woolfs form-inhaltlich ähnlich gestalteter Roman Die Wellen hält den Vergleich mit diesem Prosamonument aus." (Basler Zeitung)
"Gilt als Faulkners Hauptwerk. Auf verschiedenen Handlungs- und Zeitebenen, mit den Mitteln des Bewußtseinsstromes und in mythischen Parallelen erzählt Faulkner die Geschichte vom Niedergang der Großgrundbesitzerfamilie Compson." (Norddeutscher Rundfunk)