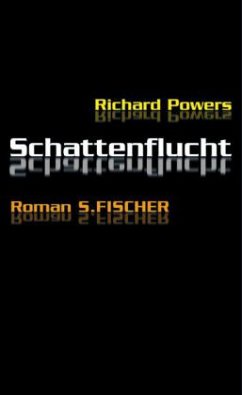Adie Klarpol landet als Zeichnerin in einem Thinktank in Seattle: hier sollen die Computerbilder laufen lernen, um den Betrachter in den Sehnsüchten des eignen Blicks zu fangen. In einer Höhle baut sie die Welt des Sichtbaren nach, eine Arbeit, die sie ganz in ihren Bann zieht.
Taimur Martin ist als Lehrer in den Libanon gekommen, von einer Zigarettenpause kehrt er nicht zurück, bleibt jahrelang als Geisel in einer Höhle isoliert. Auch er schafft künstliche Welten, nicht der Technik, sondern der Fantasie, durch die er überlebt und auf die gleichen Bilder stößt wie Adie.
Kunstvoll wie eine Doppelhelix verknüpft Richard Powers die beiden Geschichten zu einer genauen Vision über den Verlust der Sinnlichkeit im leeren Sog der Logarithmen und zu einer Liebesgeschichte, deren Charme und Poesie den Leser nicht mehr verlässt.
Taimur Martin ist als Lehrer in den Libanon gekommen, von einer Zigarettenpause kehrt er nicht zurück, bleibt jahrelang als Geisel in einer Höhle isoliert. Auch er schafft künstliche Welten, nicht der Technik, sondern der Fantasie, durch die er überlebt und auf die gleichen Bilder stößt wie Adie.
Kunstvoll wie eine Doppelhelix verknüpft Richard Powers die beiden Geschichten zu einer genauen Vision über den Verlust der Sinnlichkeit im leeren Sog der Logarithmen und zu einer Liebesgeschichte, deren Charme und Poesie den Leser nicht mehr verlässt.

Wer nichts wird, wird virtuell: Richard Powers' Höhlenmalerei
Als William Gibson 1981 in seiner Kurzgeschichte "Burning Chrome" den Begriff "Cyberspace" erfand, war dessen Karriere in den folgenden zwanzig Jahren nicht abzusehen. Die in seiner "Neuromancer"-Trilogie weiterentwickelte Vorstellung eines grenzenlosen, per Schnittstelle bewohnbaren Paralleluniversums - hier meist eher als die "Matrix" bezeichnet -, blieb zunächst Teil einer Subkultur von Science-fiction-Freaks und Cyberpunks. Doch Anfang der Neunziger eroberte die virtuelle Realität fast über Nacht die Wunsch- und Albträume der Öffentlichkeit und spaltete sie in Kulturpessimisten, die den Verlust unmittelbarer Erfahrung an die Wand malten, und Propagandisten der Virtualisierung, die den Abschied von Körperlichkeit als Befreiung der Menschheit zu göttlicher Omnipotenz verkündigten.
Paradoxerweise ließ man sich gerade zu dem Zeitpunkt vom technisch frisierten Möglichkeitssinn faszinieren, als die reale Geschichte mit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs jede Phantasie übertraf. Eine Episode in Akira Kurosawas Film "Träume" von 1990 erzählt von einem Kunststudenten, der in van Goghs Gemälde "Weizenfeld mit Krähen" hineintritt wie in eine Landschaft. In Richard Powers' neuem Roman "Schattenflucht" ist es van Goghs "Zimmer in Arles", das vorübergehend zum Zufluchtsort der Grafikerin Adie Klarpol wird. Jahre nach dem Scheitern ihrer Künstlerträume, folgt sie 1989 dem Ruf ihres Freundes Steven und nimmt eine Stelle bei der Softwareschmiede TeraSys an. In deren "Realization Lab" arbeitet eine Gruppe von Programmierern an einer virtuellen Umgebung, im Jargon "Grotte" genannt, deren dilettantischem Design Adie künstlerische Brillanz verleihen soll.
Die Computernovizin, die erst einmal die hauseigenen Grafikrechner "Rembrandt" oder "Picasso" tauft, verfällt rasch der Flut der Bilder und sieht in der Grotte die Chance der perfekten Illusion: "Ein paar Trillionen Zahlenketten, die ein paar Milliarden Jahre Evolution des Auges überlisteten." Nachdem dem ersten Projekt, einer Umsetzung von Henri Rousseaus "Traum" als begehbarem, von kunsthistorischen Verweisen bevölkertem Dschungel, mangelnde Interaktivität vorgehalten wird, macht sich Adie an ein anspruchsvolleres Ziel: eine dreidimensionale Kammer, streng nach dem Vorbild van Goghs, in der selbst die Holzdielen knarren, wenn man sie im verkabelten Zustand betritt.
Parallel erzählt Powers vom Schicksal Taimur Martins, eines amerikanischen Staatsbürgers, der 1986 als Englischlehrer in Beirut vom "Heiligen Krieg" entführt und jahrelang als Geisel festgehalten wird. Vollkommen isoliert, in einer engen Kammer eingeschlossen, flieht er seinerseits in die virtuelle Präsenz der Erinnerungen. Mit großer Eindringlichkeit, die durch die ungewöhnliche Erzählhaltung in zweiter Person Singular gesteigert wird, schildert Powers das Leiden der Geisel unter dem totalen Reizentzug, der mit unglaublicher Geistesanstrengung kompensiert wird.
Die Spannungen zwischen realen und virtuellen Räumen, zwischen der Enge von Grotte und Zelle und dem weiten Horizont der Gedankens sind ein zentrales Thema des Romans. Einer der Mitarbeiter des Labs haust in einem Wohnwagen, der mit Bildern seiner verstorbenen Geliebten vollgestopft ist. Adie und Steven lebten einst in einer Künstlerkommune mit dem Komponisten Ted zusammen, der jetzt mit Muskelschwund in einem Krankenzimmer ausgerechnet in "Lebanon, Ohio" dahinvegetiert und mit Kompositionssoftware an einem letzten Werk arbeitet. Lange bleiben die Handlungsstränge in Seattle und Beirut fast musikalisch nur durch Themen und Variationen verbunden, bis schließlich im Cyberspace eine Art mystischer Begegnung der beiden Sphären stattfindet.
Der 1957 geborene Powers bestätigt hier seinen Ruf als Schriftsteller des wissenschaftlichen Zeitalters, der in Romanen wie "The Gold Bug Variations" (1991) oder "Galatea 2.2" (1995) avancierte Disziplinen wie Molekulargenetik oder Kybernetik in der Kollision mit der kulturellen Überlieferung auf den Prüfstand stellt und zeigt, wie sie zu jenen metaphysischen Fragen führen, die sich Philosophie und Kunst seit jeher stellen. Wenn die Übersetzer die "Cavern" des Originals nicht als "Grotte", sondern als "Höhle" übertragen hätten, wäre auch hier das platonische Vorbild sichtbar geblieben. Teds Schicksal erinnert daran, daß auch hier der eigentliche Kerker, wie bei Platon, unser Körper ist.
Warum aber beschwört Powers gerade jetzt, wo Datenbrillen und Schutzanzüge längst nicht mehr dernier cri sind, das Aufbruchspathos der Cyberpioniere noch einmal herauf, das man nicht mehr ohne Lächeln goutieren kann? Tatsächlich läßt sich "Schattenflucht" auch als Künstlerroman lesen, als Allegorie auf das unvermeidliche Scheitern jeder Avantgarde, deren Radikalität früher oder später dem Markt geopfert wird. Adie - der Vorname ist als kleiner Hinweis auf Ada Lovelace, die Tochter Byrons und Mitarbeiterin des Computerpioniers Charles Babbage zu verstehen - leidet unter dem Trauma ihrer gescheiterten Karriere, die am Ende in ein Autodafé mündete. Ihr Freund Steven gab das Dichten auf und findet nun in den Programmiersprachen jene direkt wirklichkeitsverändernde Macht, die er einst dem poetischen Wort zuschrieb. Ted begann als Avantgardist, wurde aber reich mit einem dreißigsekündigen Werbejingle. Auch das interesselose Wohlgefallen der Höhlenbewohner an ihrer Grotte gerät mehr und mehr unter den Zwang der Anwendungsorientierung.
Wenn schließlich die Bemühungen des Teams auf einen detailgetreuen virtuellen Nachbau der Hagia Sophia zulaufen, scheint Powers den Kopisten als Erben des Originalgenies einzusetzen. Dem entspricht seine Poetik, die Motive der Literatur- und Kunstgeschichte variiert und für die digitale Ära aufbereitet. "Zum ersten Mal hielt die Zukunft mehr Bilder bereit als die Vergangenheit", wird einmal die Verlockung des Virtuellen beschrieben. Doch indem die neuen Futuristen von der Geschichte eingeholt werden, widerlegt Powers diesen modischen Befund. Auf einem kleinen Bildschirmfenster verfolgen die Techniker gebannt die Nachrichten aus Prag, Berlin und Bukarest, während Martin umgekehrt nach seiner mehrjährigen Geiselhaft die Welt nicht mehr wiedererkennt.
Die Schwächen des Romans liegen in den Nebenhandlungen. Wenn Ted noch am Krankenbett sein letztes Werk komponiert und den Besuchern Tränen in die Augen treibt, so ist das nicht frei von Kitsch und Pathos. Für ein Milieu von obsessiven Computerfreaks sind die Figuren zu perfekt geraten; ihre notorischen Macken lassen sich alle aus früh erlittenen Wunden erklären. Wie bei Computeranimationen ist Makellosigkeit der Illusion eher abträglich. Etwas mehr allzumenschliche Boshaftigkeit hätte auch Adie gutgetan, die sich trotz einiger Bettszenen nicht recht zu einem Wesen aus Fleisch und Blut materialisieren will. Wenn sie am Schluß, es ist die Zeit des ersten Golfkriegs, erschüttert über die mögliche militärische Nutzbarkeit ihrer Forschungen den virtuellen Kirchenraum zu einer multimedialen Antikriegsinstallation umbaut und damit das Kulturerbe der Menschheit gegen die Barbarei der Bomben aufruft, dann wird es eher peinlich.
Solcher Schlußakkorde hätte es nicht bedurft, kommentieren die Beirut-Episoden doch auf viel differenziertere Weise die globalen Konflikte, die keine Virtualisierung aus der Welt schaffen wird. Richard Powers erzählt vom Glück und Ende des digitalen Zeitalters, das die Einlösung seiner großen Hoffnungen nicht überlebte. "Fortschritt", so sagt ausgerechnet der armenische Mathematiker der Grotte, "ist Zerstörung mit dem Kompaß."
Richard Powers: "Schattenflucht". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002. 544 S., geb., 24, 90
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ganz begeistert ist Rezensent Thomas Steinfeld von Richard Powers' "nahezu historischem" Roman - er spielt in den 1980ern und endet im Golfkrieg 1991. Die großen Hoffnungen und Utopien von Künstlicher Intelligenz und virtuellen Realitäten sind bereits ausgeträumt - keine Verherrlichung von Computertechnik, im Gegenteil: "'Schattenflucht' handelt von der großen Desillusionierung", freut sich der Rezensent. Zwei Erzählstränge sind in dem Roman verwoben, die sich wie eine "Doppelhelix" zueinander verhalten, erzählt Steinfeld. Da ist einmal die Programmiererin Adie, die mit dem Computer Kunst schaffen will, und zum anderen der Lehrer Taimur, der in Beirut fünf Jahre von Islamisten gefangen gehalten wird. Beide versuchen, eine eigene Welt "mit nichts als Fantasie" zu schaffen. Beide scheitern, denn die Realität erweist sich als "stärker, weil niederträchtiger". Doch im "Aufrufen dieser Kunst" habe der Roman seine "großen Momente". In Amerika, so Steinfeld, gilt Power als "einer der ganz großen Schriftsteller", John Updike hat ihn sogar neben Thomas Mann gestellt. Die deutsche Übersetzung wird Powers Qualitäten jedoch wohl nicht so ganz gerecht. Das sei zwar "nicht die Schuld des Übersetzers", dennoch empfiehlt Steinfeld, das Buch im Original zu lesen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH