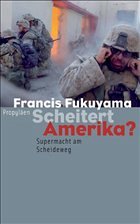Seit seinem internationalen Bestseller "Das Ende der Geschichte" (1992) gehört Francis Fukuyama zu den führenden Vordenkern der amerikanischen politischen Klasse. Immer wieder hat er sich zu internationalen Themen zu Wort gemeldet. Seine Stimme findet nicht nur in den USA, sondern auch in Europa Gehör.
In seinem neuen Buch setzt sich Fukuyama kritisch mit den Neokonservativen in Amerika auseinander, die die Bush-Administration dominieren und federführend waren bei der Formulierung der amerikanischen Antwort auf die terroristische Bedrohung seit dem 11. September 2001. Fukuyama schildert die Herkunft der neokonservativen Ideologie und ihre Durchsetzung in der amerikanischen Politik seit den neunziger Jahren. Mit dem Irakkrieg habe sich diese führende Denkschule der vergangenen Jahre selbst diskreditiert. Ihr Unilateralismus, ihr Glaube an eine amerikanische Sonderstellung, ihr Mißtrauen gegenüber den europäischen Verbündeten und der UNO haben sie in eine Sackgasse geführt – mit immensen innen- wie außenpolitischen Kosten.Scharfsinnig erörtert Fukuyama die Alternativen zur internationalen Politik der Regierung Bush und plädiert für die Rückkehr zu einer realistischen, unideologischen Außenpolitik, die von missionarischem Gebaren Abstand nimmt und Einvernehmen mit wichtigen internationalen Partnern sucht. Seine harsche Kritik an den Fehlern der Bush-Administration, namentlich am Irakkrieg, führt ihn zu überzeugenden Perspektiven für eine US-Außenpolitik nach der Ära Bush.
In seinem neuen Buch setzt sich Fukuyama kritisch mit den Neokonservativen in Amerika auseinander, die die Bush-Administration dominieren und federführend waren bei der Formulierung der amerikanischen Antwort auf die terroristische Bedrohung seit dem 11. September 2001. Fukuyama schildert die Herkunft der neokonservativen Ideologie und ihre Durchsetzung in der amerikanischen Politik seit den neunziger Jahren. Mit dem Irakkrieg habe sich diese führende Denkschule der vergangenen Jahre selbst diskreditiert. Ihr Unilateralismus, ihr Glaube an eine amerikanische Sonderstellung, ihr Mißtrauen gegenüber den europäischen Verbündeten und der UNO haben sie in eine Sackgasse geführt – mit immensen innen- wie außenpolitischen Kosten.Scharfsinnig erörtert Fukuyama die Alternativen zur internationalen Politik der Regierung Bush und plädiert für die Rückkehr zu einer realistischen, unideologischen Außenpolitik, die von missionarischem Gebaren Abstand nimmt und Einvernehmen mit wichtigen internationalen Partnern sucht. Seine harsche Kritik an den Fehlern der Bush-Administration, namentlich am Irakkrieg, führt ihn zu überzeugenden Perspektiven für eine US-Außenpolitik nach der Ära Bush.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Claus Leggewie macht keinen Hehl daraus, dass er Francis Fukuyama, politischer Ökonom der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore und seit seiner These vom "Ende der Geschichte" weltbekannt, für reichlich überschätzt hält. Auch Fukuyamas Abkehr vom Neokonservativismus und der Irak-Politik der Bush-Regierung, zuerst in einem Artikel im neokonservativen Magazin "The National Interest" dargestellt und begründet und nun ausgewalzt in "sieben redundanten Kapiteln" zu einem angeblich hochaktuellen polithistorischen Megaseller, findet Leggewie eher ermüdend. Nichts Neues finde sich in "Scheitert Amerika?"; alles, was das Buch an Argumenten und Analysen auftischt, hat Leggewie schon andernorts gelesen, und besser dargestellt. Fukuyama plädiert für etwas, das er "realistischen Wilsonianismus" nennt. Dahinter verbirgt sich, so Leggewies Diagnose, eine US-Außenpolitik, die zwar "moralisch inspiriert" ist, "aber von der Wirklichkeit ernüchtert" - also ein verantwortungsvoller Multilateralismus statt eigensinnigem Unilateralismus. Die Schrift Fukuyamas bezeichnet der Rezensent schonungslos als "wenig originell und eigentlich sehr provinziell".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der Neokonservative Francis Fukuyama unterbreitet Vorschläge für die amerikanische Außenpolitik: Otto von Bismarck als Vorbild
Armer Fukuyama! Da haben wir einen intelligenten und lernbereiten Neokonservativen, der ohne Konvertiten-Übertreibungen eine maßvolle Selbstkritik der amerikanischen Außenpolitik vorlegt. Und wie ist das Echo darauf in der vor Selbstgerechtigkeit beinahe platzenden deutschen Publizistik? Sie reduziert ihn auf ein "Medienereignis" und nennt seine Schrift "wenig originell und eigentlich sehr provinziell" (Claus Leggewie) oder stilisiert ihn als jemanden, der "um den eigenen Ruf kämpft" (Andrian Kreye). Vermutlich kommt es zu dieser Blickverzerrung, weil im Lager der europäischen, übrigens auch mancher amerikanischer Kritiker der Bush-Regierung eine Art Pseudopsychologisierung modisch geworden ist. Man stützt seine Urteile auf Netzwerk-Feindbilder, also etwa "die Neokonservativen" - andere verweisen auf die "Israel-Lobby" -, die als über die Maßen wirkungsmächtige und untereinander verschworene Akteure stigmatisiert werden. So kann man sich und anderen suggerieren, die amerikanische Außenpolitik befinde sich derzeit in unrechtmäßigen Händen, sie sei ihrer eigentlichen Bestimmung und ihren eigentlich berechtigten Gestaltern gewissermaßen entführt worden. Es ist genau diese Meinung, die man auch im ansonsten politisch hellhörigen deutschen Bildungsbürgertum heute allenthalben antrifft.
Dabei befindet sich die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik allenfalls in ungeschickten Händen. Das neue Buch von Fukuyama kann als eine sorgsame Fehleranalyse eines besonders wichtigen Teils dieser Politik gelten. Gemeint sind der Kampf gegen den internationalen Terrorismus und, damit verbunden, der selektiv-aktivistische Demokratie-Export mittels gewaltsamen Regimewechsels in einigen besonders amerikafeindlich eingestellten Ländern. Zu diesem Zweck geht Fukuyama noch einmal auf die Entstehungsgeschichte des Neokonservatismus ein. Viele seiner Anhänger sind enttäuschte Linke, die einen rigiden Antikommunismus mit der Vorstellung verknüpft haben, Amerika müsse die Welt reif für die Demokratie machen. Nach dem Ende der Sowjetunion war der Antikommunismus genauso obsolet geworden wie der Kommunismus. Die Neokonservativen sahen jetzt die einmalige Chance zur Verwirklichung einer demokratischen Weltordnung nach westlichem Vorbild. Dieser "unipolare Moment" währte nur kurz - das haben Momente so an sich. Als sich Gegenströmungen bildeten und als die verschiedenen "Friedensmissionen" und "Friedensprozesse" im Sande zu verlaufen begannen, verstärkte sich in den Vereinigten Staaten kurzfristig die Attraktivität einer nationalistisch-isolationistischen Politik. Der ist aber längst durch die Globalisierung die Grundlage abhanden gekommen. Mit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 schwang das Pendel wieder um. Im Kampf gegen den Terrorismus wurden nicht selten Mittel eingesetzt, welche jenseits der Grenzen von Legalität und Legitimität angesiedelt waren. Der Einsatz militärischer Gewalt, auch als vorbeugende Maßnahme, erhielt hohe Priorität. Und weil man glaubte, daß die demokratiekonformen Zwecke solche Mittel und Maßnahmen unverzüglich heiligen würden, wurde schlecht informiert und schlecht vorbereitet sowie gegen die Haltung vieler Verbündeter der Krieg im Irak begonnen.
Jetzt stecken die Vereinigten Staaten in dem Schlamassel, aus dem sie sich noch lange nicht befreit haben werden. Inzwischen ist aber der Traum von der unaufhaltsamen Verbreitung der Demokratie in der Welt ausgeträumt. Was tun? Für Fukuyama ist klar, daß es gründliche Kurskorrekturen an der amerikanischen Außenpolitik geben muß, viel weiter gehende, als sie Präsident Bush für seine zweite Amtszeit angekündigt hat. Ihren moralisch-missionarischen Grundton soll diese verbesserte Außenpolitik beibehalten. Jedoch sollen die überlieferten, skeptisch-realistischen Einsichten über den begrenzten Nutzen militärischer Macht und die in jeder Beziehung kostengünstigeren Vorzüge multilateraler Diplomatie und anderer "weicher" Machtmittel wieder neu zu Ehren gelangen. Als Etikett für eine solchermaßen europäischer gewordene Außenpolitik schlägt Fukuyama den sperrigen Begriff des "realistischen Wilsonianismus" vor, womit er kaum einen Preis für begriffliche und konzeptionelle Eleganz gewinnen wird. Als Vorbild für diese Art Politik verweist er übrigens auf Otto von Bismarck, der zwar ein ausgefuchster und erfolgreicher Reichsgründer und Außenpolitiker war, aber von dem Gedanken der Ausbreitung der Demokratie nichts hielt. Unabhängig von dieser schiefen Parallele wird man Fukuyama das Kompliment nicht vorenthalten können, seine Kritik an der gegenwärtigen amerikanischen Außenpolitik gut begründet zu haben.
WILFRIED VON BREDOW
Francis Fukuyama: Scheitert Amerika? Supermacht am Scheideweg. Aus dem Amerikanischen von Udo Rennert. Propyläen Verlag, Berlin 2006. 220 S., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main