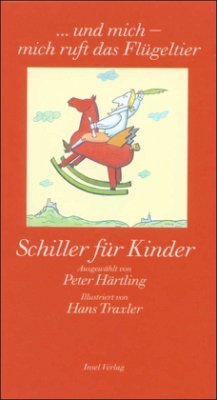Was bereits für den erfolgreichen Band Goethe für Kinder galt, trifft auch auf dieses Buch zu: Einen klassischen Autor für Kinder neu zu erschließen ist ein lohnendes Unterfangen. Denn manche Vorurteile sind abzubauen; nicht immer wurden und werden Schillers Balladen im Deutschunterricht als Freude empfunden. Vermutlich kommt es darauf an, wer uns die Klassiker vermittelt.
Peter Härtling ist es, gemeinsam mit Hans Traxler, gelungen, einen neuen, von alten Zwängen unverstellten Zugang zu eröffnen, das scheinbar Vertraute in neuer Perspektive zu zeigen und neben bekannten auch weniger bekannte, komische und humorvolle Texte des Klassikers zu versammeln. Dabei zeigt sich Schiller auch von einer erstaunlich nichtklassischen Seite, vor allem, wenn ihn der Alltag plagte. Als er, beispielsweise, mit dem Don Carlos nicht so recht vorankam, weil ihn der Lärm des Waschtags beim Dichten störte, machte er seinem Ärger Luft mit einer scherzhaften Bittschrift, die er an die "weibliche Waschdeputation" richtete: "Die Wäsche klatscht vor meiner Tür, / es scharrt die Küchenzofe - / und mich - mich ruft das Flügeltier / nach Königs Philipps Hofe."
Peter Härtling ist es, gemeinsam mit Hans Traxler, gelungen, einen neuen, von alten Zwängen unverstellten Zugang zu eröffnen, das scheinbar Vertraute in neuer Perspektive zu zeigen und neben bekannten auch weniger bekannte, komische und humorvolle Texte des Klassikers zu versammeln. Dabei zeigt sich Schiller auch von einer erstaunlich nichtklassischen Seite, vor allem, wenn ihn der Alltag plagte. Als er, beispielsweise, mit dem Don Carlos nicht so recht vorankam, weil ihn der Lärm des Waschtags beim Dichten störte, machte er seinem Ärger Luft mit einer scherzhaften Bittschrift, die er an die "weibliche Waschdeputation" richtete: "Die Wäsche klatscht vor meiner Tür, / es scharrt die Küchenzofe - / und mich - mich ruft das Flügeltier / nach Königs Philipps Hofe."

Wie die Kinder- und Jugendbücher uns den Dichter nahebringen
Man hört immer wieder von Eltern und Pädagogen, die Texte von Friedrich Schiller seien Kindern und Jugendlichen nicht zuzumuten. Einerseits seien sie sprachlich und inhaltlich zu fremdartig für die Generation, die den Namen Homer allenfalls mit dem Oberhaupt der Simpsons assoziiert. Andererseits hingen einem die massenweise in den kleinbürgerlichen Zitatenschatz der Älteren eingesickerten Schiller-Losungen bald zum Halse heraus. Das ist nicht nur ein dämliches Vorurteil, sondern auch ein gefährliches. Denn es überschattet alle Versuche, Schillers Gedichte, Balladen und Theaterstücke einem coolen jugendlichen Publikum nahezubringen. Wer das unternimmt, dessen Motive triefen oft vor defensiver Wohlgemeintheit. Das verdirbt sie teilweise, läßt sie jedenfalls ganz ohne Not ihre Zwecke verfehlen.
Noch am wenigsten trifft das auf die Bilder und Illustrationen in den Schiller-Büchern für den Nachwuchs zu. Hans Traxler gibt mit seinen freundlich-sarkastischen Bildern der etwas behäbig daherkommenden "Schiller-für-Kinder"-Anthologie Peter Härtlings einen genialischen Zug. Klaus Ensikat hat die leicht erratische Nacherzählung der Handlung von "Wilhelm Tell" durch Barbara Kindermann mit einer Bilderflut voll irritierender Idyllik verfremdet und dadurch nähergebracht. Jacky Gleichs Illustrationen der Ballade (Schiller nannte sie eine Erzählung) "Der Handschuh" charakterisiert alle auftretenden Personen und Tiere witzig und derart eindrücklich, daß sich der verspielte Text mit seiner klaren Botschaft von der Notwendigkeit des Respekts zwischen den Menschen mit einem Mal ganz von selbst aufschließt.
"Der Handschuh" erschien in der Reihe "Poesie für Kinder", die Tell-Nacherzählung in der Reihe "Weltliteratur für Kinder", beide im Kindermann Verlag. Braucht es solche speziellen Textschubladen? Müssen "die Klassiker" und andere E-Literatur erst kindergerecht aufgearbeitet werden, um wirken zu können? Grundsätzlich ist da Skepsis geboten. Was in der Poesie-Reihe überzeugt, weil hier die originale Sprache Schillers präsentiert wird, ist im Fall des "Wilhelm Tell" ganz verfehlt. Eine Nacherzählung, auch noch in simplifizierender Form, mit eingestreuten Originalzitaten, um zwischendurch einen "authentischen Eindruck von Schillers Werk" einzustreuen, das führt eher weg von der Dramatik des Theaterstücks und verführt ihre Leser nur zur Selbsttäuschung à la "Wilhelm Tell - klar, kenn ich doch!" Eben nicht. Solche Selbsttäuschungsangebote im Mantel der guten Absicht, die jugendlichen Leser an die Klassiker heranzuführen, bewirken wohlmeinend genau das Falsche.
Die Schiller-Biographien für junge Leser haben auch ihre Tücken. Harald Gerlach hat sich Schiller und vor allem der Literatur über Schiller mit gedämpfter Begeisterung genähert. Man lernt aus seiner vergleichsweise kurzen Lebensbeschreibung, daß auch die Fachleute über viele Episoden in Schillers schwierigem Leben kaum etwas wissen. Gerlach verläßt sich in starkem Maße auf die Aussagen der Zeitzeugen, die er mit etlichen intuitiven Überlegungen durchsetzt. Auf diese Weise bekommen wir ein ganz lebendiges Bild vom "armen Friedrich Schiller" und seinen wenig erfreulichen Lebensumständen von der Kindheit bis zum frühen Tod. Von der Fülle und dem immensen Feuer der Gedanken Schillers, die er in Auseinandersetzung mit den scharfsinnigsten Zeitgenossen der Aufklärung entwickelte, lesen wir bei Gerlach viel zuwenig. So taucht der Name Kant, dessen Philosophie für Schiller eine geradezu existentielle Herausforderung wurde, hier überhaupt nicht auf. Harald Gerlach ist 2001 gestorben; man hat den Eindruck, daß diese Biographie ein Fragment geblieben ist. Und daß sie sich speziell für jugendliche Leser empfiehlt, wie Professor Dr. Lothar Ehrlich von der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen in einem ledrigen und nachhaltig abtörnenden Geleitwort schreibt, ist nicht nachvollziehbar.
Manfred Mai macht es diesbezüglich besser. Der Gebrauchswert seiner Biographie wird vor allem auch durch die langen Passagen mit Ausschnitten aus Schillers Werken erhöht. Da wird eben nicht nacherzählt, sondern die originale und originelle Sprache Schillers kommt zu Gehör. Nicht alle Leser zwischen dreizehn und achtzehn Jahren werden damit gleich etwas anfangen können. Aber sie können es wenigstens probieren. Und wenn ihre Lehrerinnen und Lehrer die eigene generationsspezifische wohlmeinende Schiller-Unlust gar hintanstellen können, vielleicht sogar mit Erfolg. Mai selbst ist sprachlich nicht immer auf der Höhe seines vernünftigen Konzepts. Ein Satz wie "Neben der liebevollen und gutmütigen Mutter sorgte auch die Schwester dafür, daß der Junge gefühlsmäßig nicht zu kurz kam" bereitet Halsschmerzen. Aber Schillers Sätze helfen darüber hinweg. Zum Glück stehen ganz viele davon in dieser insgesamt nützlichen Biographie.
WILFRIED VON BREDOW
Manfred Mai: "Was macht den Mensch zum Menschen?" Friedrich Schiller. Carl Hanser Verlag, München 2004. 304 S., geb., 16,90 [Euro]. Ab 12 J.
Harald Gerlach: "Man liebt nur, was einen in Freyheit setzt". Die Lebensgeschichte des Friedrich Schiller. Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim 2004. 191 S., geb., 14,90 [Euro]. Ab 12 J.
Peter Härtling (Hg.): "Und mich - mich ruft das Flügeltier". Schiller für Kinder. Illustriert von Hans Traxler. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2004. 93 S., geb., 14,80 [Euro]. Ab 6 J.
Barbara Kindermann: "Wilhelm Tell". Nach Friedrich Schiller neu erzählt. Mit Bildern von Klaus Ensikat. Kindermann Verlag, Berlin 2004. 34 S., geb., 15,50 [Euro]. Ab 6 J.
Friedrich Schiller: "Der Handschuh". Mit Bildern von Jacky Gleich. Kindermann Verlag, Berlin 2005. 24 S., geb., 14,50 [Euro]. Ab 4 J.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensent Rolf-Bernhard Essig blickt schon ins Jahr 2005 - zum 200. Todestag von Friedrich Schiller - und berichtet in einer umfassenden Sammelrezension, was es Neues gibt am Horizont der Schiller-Literatur. Der "liebevoll-ironische" Text- und Bildband, der von Peter Härtling ausgewählte Schiller-Texte mit Illustrationen von Hans Traxler verbindet, hat dem Rezensenten offenbar gut gefallen. Ob der "Schiller für Kinder" auch wirklich etwas für Kinder ist, daran hat der Rezensent allerdings so seine Zweifel, hat sein Test an einer Zwölfjährigen doch vor allem den durchschlagenden Erfolg der Bilder ("toll") bescheinigt. Die Schillerschen Balladen jedoch blieben nach Auskunft des Rezensenten "trotz Erläuterungen" nur "schwer verständlich".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH