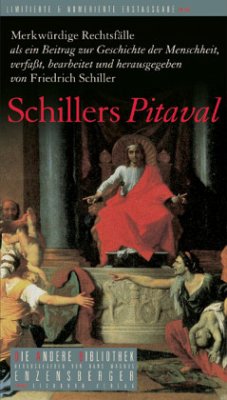Schiller, der sich zeit seines Lebens mit Geldproblemen herumschlagen musste, wäre heute reich. Er hätte die rasanten Drehbücher geschrieben, an denen es dem deutschen Film fehlt; vielleicht wäre er - wer weiß - sogar in Hollywood gelandet. Denn er hatte einen untrüglichen Sinn für gute Stoffe, ein dramaturgisches Können von hohen Graden und keine Angst vor sensationellen Geschichten.

Friedrich Schiller als Erzähler und Dramatiker von Rechtsfällen
Pitaval steht bis heute als Name für ein Programm. Auf dem Buchmarkt tummeln sich neben einem Berliner, Dresdner oder Pfälzer Pitaval thematische Fallsammlungen aus Gerichtsmedizin und Kriminalgeschichte - selbst der Heckenschütze von Washington wird inzwischen als Pitaval-Geschichte gehandelt. Der französische Jurist François Gayot de Pitaval hat das Genre authentischer Rechtsfälle mit seinen "Causes célèbres et intéressantes" (1734-1743) begründet. Seine Sammlung in zwanzig Bänden gelangte zu ähnlicher Popularität wie heute die Gerichtsshows. Nach einhundert Jahren war der "Neue Pitaval" unter Julius Hitzig und Willibald Alexis bereits auf sechzig Bände angewachsen, von vielen Kriminalautoren begierig als Quelle genutzt.
Zu einem begeisterten Anhänger dieser Mode wird auch Friedrich Schiller, der in den Jahren zwischen 1792 und 1795 eine eigene Pitaval-Ausgabe in vier Bänden herausgibt. In Auswahl ist sie jetzt mit einem schönen Nachwort und hilfreichen Kommentaren von Oliver Tekolf in der Anderen Bibliothek bei Eichborn erschienen. Schillers Interesse für wahre Rechtsfälle beginnt aber schon über zehn Jahre früher mit den "Räubern". In der Vorrede erklärt er das "innere Räderwerk" des Lasters und den "großen Bösewicht" zu seinen eigensten Gegenständen. Beikommen will er ihnen mit der "dramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen". Wenig später entwickelt er in der "wahren Geschichte" "Verbrecher aus Infamie" die gleiche Faszination für eine psychologische "Leichenöffnung des Lasters". Schiller will zeigen, wie ein Verbrecher "seine Handlung nicht bloß vollbringen, sondern auch wollen" kann. Die inneren Motivationen des Delinquenten vor der Tat sollen für das "selbst zu Gericht sitzende" Publikum entfaltet werden, das so gleichermaßen unterhalten und unterrichtet wird.
Mit dieser Strategie wie mit der Verarbeitung historisch verbürgter Fälle tritt Schiller von Anfang an in die Fußstapfen Pitavals. Der erklärt in seiner eigenen Vorrede von 1734, daß er seine Leser lieber vergnügen als mit der "rauhen juristischen Schreibart" verschrecken wolle, Romane aber wegen deren "Unwahrheit" ablehne. In seiner Ausgabe ersetzt Schiller Pitavals Vorrede durch eine eigene. Sie knüpft an die beiden programmatischen Einleitungen zu den "Räubern" und zum "Verbrecher" an. Schiller rühmt den Vorzug der historischen Wahrheit, mit der sich die "Divinationsgabe" des Lesers für die "verborgenen Gänge der Intrige" schärfen lasse und die zugleich den Richtern "tiefere Blicke in das Menschenherz" gewähre. Im Gegensatz zur nüchternen "Geschichtserzählung", also der juristischen "Species facti", verspreche erst die literarische Behandlung jenes prickelnde Vergnügen, "die Erwartung aufs Höchste zu treiben".
Wie souverän Schiller ebendies beherrscht, ist seinem "Verbrecher aus Infamie", den Tekolf "Schillers Pitaval" beifügt, deutlich anzumerken, vor allem wenn man diesen Text mit einer anderen Fassung des Falls durch seinen Lehrer Jakob Friedrich Abel vergleicht. Letztlich hat der Publikumsgeschmack ihn zu dieser Kunstfertigkeit getrieben, denn Schiller wußte, daß seine Zeitschrift "Thalia" nur überleben würde, wenn auch das "Bizarre" und "Piquante" Aufnahme fände. Eine Kostprobe für die zweite Kategorie ist das "Merkwürdige Beispiel einer weiblichen Rache", ebenfalls in der "Thalia" wie zusätzlich in Tekolfs Ausgabe erschienen. Diese Erzählung wird in Ausgaben und Handbüchern als ein Text Schillers behandelt, obgleich es sich um die Übersetzung eines Auszuges aus Diderots noch unpubliziertem Roman "Jacques le fataliste" handelt.
Schiller reizt daran die Kühnheit der Intrige, mit der eine Dame von Stand ihren abenteuerlustigen Liebhaber zum betrogenen Betrüger macht. Sie bestraft seine Untreue durch eine geschickt arrangierte Vermählung mit einer gedungenen Buhldirne, verkleidet als Unschuld. Pitavals Geschichten sind um nichts weniger delikat, besonders schön etwa die Erzählung "Das ungleiche Ehepaar". Sie handelt von einem uralten Wollüstling, der seine jugendliche Frau so lange durch Eifersucht triezt, bis diese ihn mit inszenierten Geistererscheinungen in Furcht und Schrecken versetzt. Von hier mag Schiller Anregungen für das Spektakel im "Geisterseher" bezogen haben. Aber auch die Dramen behandeln wie im Falle von "Don Carlos", "Maria Stuart" oder "Wilhelm Tell" Stoffe, die schon in den "Causes célèbres" vorkommen. Schiller hat ferner eine Bearbeitung von Pitavals "Marquise von Gange" geplant, die später de Sade in seinem letzten Roman und der ältere Alexandre Dumas in seinen "Causes célèbres" ausführten. Und auf die Geschichte der "Marquise von Brinvillier", die man aus E. T. A. Hoffmanns "Fräulein von Scuderi" kennt, verweist er schon in einer Fußnote zu den "Räubern".
Den greifbarsten Einfluß auf ein Drama Schillers kann aber Pitavals "Geschichte der Johanne von Arc oder des Mädchens von Orleans" beanspruchen, deren Titelheldin in Schillers Version auf dem Schlachtfeld statt dem Scheiterhaufen stirbt. Tekolf nimmt diese etwas spröde Historie wie die anderen erwähnten möglichen Vorlagen in seine Auswahl auf. Dieser Rechtsfall ist im Kern mythisch-legendär und weniger konkret als etwa die Frage versuchter Körperverletzung oder Tötung im "Wilhelm Tell", die Diskussion von Notwehr, Widerstandsrecht und Freiheitsutopie im "Fiesko" oder "Don Karlos", die politische Instrumentalisierung des Rechts in "Maria Stuart", die Tatbestände von Freiheitsberaubung, Nötigung und Menschenhandel in "Kabale und Liebe" oder die Anarchie und Usurpation im primitiven Rechtsempfinden der "Räuber", wo Kollateralschäden sich häufen.
In diesem Sinne begibt sich Klaus Lüderssen mit seiner Studie "Schiller und das Recht" auf eine juristische Spurensuche, die er im ersten Teil durch anregende theoretische, oft auch aktuelle politische Überlegungen flankiert. Zum einen geht es um den Aufstieg des modernen Strafrechts aus dem Konflikt zwischen Machtstrategie und Kulturleistung. Zum anderen um die alte Verwandtschaft zwischen Jurisprudenz und Literaturwissenschaft, die schon auf den ursprünglichen Begriff vom Germanisten als dem Erforscher des germanischen Rechts zurückgeht. Beide Disziplinen sind im Kern hermeneutisch, Lüderssen bringt sie aber noch enger zusammen: Der literarischen Darstellung des Rechts räumt er reichere Interpretationshorizonte ein, umgekehrt versteht er das Recht - analog zu Hayden Whites Begriff von Geschichte - als Konstruktion, die ohne sprachlich-literarische Gestaltung gar nicht denkbar wäre. Als Narrativist unter den Juristen erhofft sich Lüderssen so die Wiedererlangung von Deutungsperspektiven, die in den abstrakt-begrifflichen Argumentationstheorien seiner Zunft verlorengegangen sind. Die zunehmende Laienbeteiligung am Rechtswesen könne dazu ebenso beitragen wie die Literatur selbst.
Daß Lüderssen sich angesichts solch reflektierter Einsichten bloß auf das dramatische Werk Schillers beschränkt, weil die Prosa rechtshistorisch besser erschlossen sei, ist freilich bedauerlich. Für die Erzählung "Verbrecher aus Infamie" mag das zutreffen, nicht aber für die anderen Erzählwerke und historischen Schriften, die Essays und Balladen, die von zivilen oder öffentlichen Rechtsfragen, bis hin zur juristischen Metaphorik, nur so wimmeln. Pitaval und die vorangehende Tradition der "Histoires tragiques" - also der seit dem frühen siebzehnten Jahrhundert populären Sammlungen schrecklicher Chroniken und tragischer Sensationsgeschichten, die über Sprach- und Landesgrenzen hinweg ausgetauscht werden - sind bisher nur in Ansätzen bekannt und hinterlassen in der Schiller-Forschung kaum Spuren.
Von Schillers Forderung am Ende seiner Pitaval-Vorrede, diese Sammlung nach und nach zu einem international "vollständigen Magazin für diese Gattung zu erheben", sind wir also noch weit entfernt. Schiller durchschaut als Historiker lange vor Hayden White die Fiktionalität des Faktischen, in der Antrittsvorlesung betont er etwa, daß historische "Bruchstücke nur durch künstliche Bindungsglieder verkettet" werden können. Als Dichter erkennt er die europaweite Tendenz, aus dokumentarischen Überlieferungen Literatur zu schaffen. Und als Anthropologe sieht er die Chance, die an der Wende vom Tat- zum Täterstrafrecht neu aufkommende Kriminalpsychologie zur literarischen Rechtsaufklärung zu nutzen. Damit entwirft er ein heute aktuell werdendes Forschungsprojekt, das die vergleichende Literaturwissenschaft mit der Rechts- und Medizingeschichte verbinden könnte. Zu dieser reizvollen Vision Schillers leisten beide Bücher wertvolle Beiträge.
Oliver Tekolf: "Schillers Pitaval". Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit, verfaßt, bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Schiller. Die Andere Bibliothek im Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2005. 451 S., geb., 32,- [Euro].
Klaus Lüderssen: "Daß nicht der Nutzen des Staats Euch als Gerechtigkeit erscheine". Schiller und das Recht. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 2005. 222 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Yaak Karsunke ist von dieser Ausgabe des von Friedrich Schiller edierten "Pitaval", einer Sammlung von zwischen 1734 und 1743 im französischen Original erschienen Kriminalfällen, sehr angetan. Pitaval war ein erfolgreicher Anwalt, dessen Interesse an den Kriminalfällen nicht so sehr dem Verbrechen an sich als vielmehr den juristischen Implikationen galt und der sich als "überaus justizkritischer Autor" erweist, erklärt Karsunke. Der Herausgeber Oliver Tekolf hat in seiner Auswahl der Kriminalfälle nicht nur viele Auszüge aus den Verhandlungsschriften, sondern auch zahlreiche, das Verständnis erleichternde Anmerkungen versammelt, lobt der Rezensent. Außerdem habe Tekolf Schillers "Verbrecher aus Infamie" und einen von Schiller übersetzten Auszug aus einem Roman von Denis Diderot beigegeben. Die Fallsammlung ist, wie der Rezensent findet, nicht nur als Zeugnis der Rechtspraxis der Zeit interessant, sondern auch als "kulturgeschichtliches" Dokument aufschlussreich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH