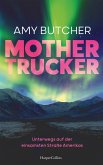Fünfzehn radikale Lebensäußerungen, geschrieben von einem der großen Ausnahmetalente der deutschsprachigen Literatur.
In fünfzehn Episoden sprengt Helene Hegemann mit luzidem Blick und großer sprachlicher Wucht sämtliche Kategorien, über die wir die Gegenwart zu begreifen versuchen.
Ein Pfau wird mit einem Golfschläger getötet und entlarvt die Doppelmoral der amerikanischen Kulturelite. Eine junge Frau will zu ihren Eltern in die österreichische Provinz fahren und verpasst immer wieder ihre Station. Ein Bad in der Wolga markiert das Ende einer zerstörerischen Beziehung. Ein Junge verliebt sich in einen anderen, während sie von fünfzig Wildschweinen umzingelt werden. Eine Snowboarderin wacht unter einer Schneedecke auf. Ein Gemälde von Monet stürzt einen Kunstexperten in eine tiefe Sinnkrise. Es sind versehrte, kraftvolle Figuren, die Helene Hegemann durch das Buch und eine Welt wandern lässt, in der Gewalt am gefährlichsten ist, wenn sie unterdrückt werden soll,in der das Abarbeiten an Widersprüchen schmerzhaft, aber auch ein großes Vergnügen sein kann. Nach und nach setzt sich ein perfide konstruiertes Psychogramm unserer Gesellschaft zusammen, das verstörend und beglückend zugleich ist.
»Ich lief auf die Wolga zu, zog im Gehen meine Klamotten aus. Ich blieb so lang unter Wasser, bis mein Körper wieder atmen wollte.«
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
In fünfzehn Episoden sprengt Helene Hegemann mit luzidem Blick und großer sprachlicher Wucht sämtliche Kategorien, über die wir die Gegenwart zu begreifen versuchen.
Ein Pfau wird mit einem Golfschläger getötet und entlarvt die Doppelmoral der amerikanischen Kulturelite. Eine junge Frau will zu ihren Eltern in die österreichische Provinz fahren und verpasst immer wieder ihre Station. Ein Bad in der Wolga markiert das Ende einer zerstörerischen Beziehung. Ein Junge verliebt sich in einen anderen, während sie von fünfzig Wildschweinen umzingelt werden. Eine Snowboarderin wacht unter einer Schneedecke auf. Ein Gemälde von Monet stürzt einen Kunstexperten in eine tiefe Sinnkrise. Es sind versehrte, kraftvolle Figuren, die Helene Hegemann durch das Buch und eine Welt wandern lässt, in der Gewalt am gefährlichsten ist, wenn sie unterdrückt werden soll,in der das Abarbeiten an Widersprüchen schmerzhaft, aber auch ein großes Vergnügen sein kann. Nach und nach setzt sich ein perfide konstruiertes Psychogramm unserer Gesellschaft zusammen, das verstörend und beglückend zugleich ist.
»Ich lief auf die Wolga zu, zog im Gehen meine Klamotten aus. Ich blieb so lang unter Wasser, bis mein Körper wieder atmen wollte.«
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Rezensent Wolfgang Schneider arbeitet sich an den Erzählungen von Helene Hegemann ab. Gelangweilt hat er sich nicht, muss er zugeben. Hegemann verstehe sich auf Pointen, starke Sätze und markante Szenen, auch ihre Zeitgeistigkeit und Abgebrühtheit ringen dem Kritiker einen gewissen Respekt ab. Aber da sich Hegemann jeder Erzähllogik, Psychologie und literarischer Feinarbeit verweigert, wie Schneider meint, werden ihm die struktuellen Schwächen ihrer Erzählungen offensichtlich: Ohne echten Zusammenhang reihe Hegemann einfach Erlebnisse, Gedanken und Zitate mit großer "Lust am Grellen" aneinander. Hegemanns Posen des Überdruss gehen ihm dabei ebenso auf die Nerven wie die zur Schau gestellte Weitläufigkeit und die "kleinen nadelspitzen Gefühllosigkeiten".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Wolfgang Schneider arbeitet sich an den Erzählungen von Helene Hegemann ab. Gelangweilt hat er sich nicht, muss er zugeben. Hegemann verstehe sich auf Pointen, starke Sätze und markante Szenen, auch ihre Zeitgeistigkeit und Abgebrühtheit ringen dem Kritiker einen gewissen Respekt ab. Aber da sich Hegemann jeder Erzähllogik, Psychologie und literarischer Feinarbeit verweigert, wie Schneider meint, werden ihm die struktuellen Schwächen ihrer Erzählungen offensichtlich: Ohne echten Zusammenhang reihe Hegemann einfach Erlebnisse, Gedanken und Zitate mit großer "Lust am Grellen" aneinander. Hegemanns Posen des Überdruss gehen ihm dabei ebenso auf die Nerven wie die zur Schau gestellte Weitläufigkeit und die "kleinen nadelspitzen Gefühllosigkeiten".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Mit geringer Erzähllogik Groteskes und Krasses aneinanderreihen, um es als Figur auszugeben: Helene Hegemanns Kurzgeschichtenband "Schlachtensee"
Mit siebzehn Jahren wurde Helene Hegemann zum "Wunderkind der Bohème". Ihr Roman "Axolotl Roadkill" wurde für seine vermeintliche "Authentizität" bejubelt und von vorwiegend älteren Kritikern als brisanter Report aus der jugendlichen Feierzone gelesen. Als sich dann aber herausstellte, dass Hegemann mehr zitiert als erlebt hatte, schlug die Stimmung jäh um: Plagiat, Machwerk! Bis man nach langen Debatten schließlich übereinkam, gerade darin eine besonders zeitgemäße Form des Schreibens zu sehen. Zwölf Jahre und einige Bücher später ist Helene Hegemann eine arrivierte Autorin - und doch versprechen sich viele von ihr immer noch eine erhöhte Dosis Gegenwärtigkeit.
Was könnte gegenwärtiger sein als eine Oligarchennovelle? Um Wohlstandsverwahrlosung auf höchstem Niveau geht es in der mit sechzig Seiten längsten Geschichte von Hegemanns neuem Erzählband "Schlachtensee". Die Ich-Erzählerin schildert Erlebnisse mit dem milliardenschweren Russen Arkadij und den Frauen in seinem Bannkreis. Der Oligarch ist nach der skrupellosen Phase des Vermögenserwerbs ins Spätstadium des Philanthropen übergegangen, gründet Stiftungen und Kinderkrankenhäuser. Die Erzählerin vergisst aber nicht, dass an seinem Geld "Gehirnmasse" klebt. Und dass er Freunde hat, vor denen man sich in Acht nehmen muss, auch wenn Arkadij zu martialischem Gefasel neigt: "Er setzte zu einem ausführlichen Monolog über Kumpels an, die im Jugoslawienkrieg schwangere Frauen getötet hätten und in deren Gesichtern man seitdem das Jenseits sehe. Blabla." Dergleichen als "Blabla" abzutun erfordert einige Abgebrühtheit. Ist es ein Versuch, die Souveränität über die monströse Männlichkeit zurückzugewinnen? Jedenfalls versucht die Erzählerin zu ergründen, was sie an solchen Männern fasziniert: "Man fährt als Frau nicht auf Macht als solche ab bei diesem im Brei ihrer Außenwirkung versunkenen Berserkern, man fährt auf eine spezielle Eigenschaft ab, die zu Macht führt." Das ist, eher selten bei Hegemann, mal ein Ansatz von subtilerer Psychologie. Es lässt sich hinzufügen: Das Überbordende, Exzessive der Oligarchenexistenz kommt Hegemanns Poetik der Überbietung maximal entgegen. Weniger Normal geht nicht.
Wegen ihrer vielen Abschweifungen lässt sich diese Geschichte (wie auch die meisten anderen) kaum nacherzählen. Mit geringer Erzähllogik folgen tendenziell krasse oder groteske Erlebnisse in episodischer Reihung aufeinander. Etwa so: "Ihr schwuler Heilpraktiker rief an. Wir gingen mit ihm in ein Bordell. Er war gar nicht schwul. Maria war einfach davon ausgegangen, dass Heilpraktiker immer schwul wären. Wir setzten uns an den Tresen, tranken acht Tequila und ließen uns von einer brasilianischen Prostituierten Fotos vom Abiball ihrer Tochter zeigen." Schöne Pointe. Es endet mit einem Bad in der verseuchten Wolga, wobei die Erzählerin beinahe mit einer verwesten Kuh kollidiert und sich eine üble Krankheit einfängt. Die notorische Liebe zu Russland - Achtung, Aktualität! - wird auf eine harte Probe gestellt.
Ungemein weltläufig geht es in den fünfzehn Geschichten zu. Krasnoslobodsk, Kalifornien, Kanada, Ägypten, die Schweiz - man kennt sich aus; versteht sich von selbst, dass man weit herumkommt. Nur der titelgebende Berliner Schlachtensee ist eine trügerische Fährte, er spielt im Buch keine Rolle, auch wenn die vielleicht beste Story in einem Kaff an einem Badesee spielt, wo es Wildschweine von bedrohlicher Zahl und Größe gibt. Sie wirken wie "Zeppeline auf Kokain". Das mag auch daran liegen, dass die Figuren - feierfreudige junge Menschen - Drogen und Drinks in hoher Dosis konsumieren. Im Zentrum des bisweilen ins Traumhafte kippenden Geschehens steht eine gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte. Ein junger Mann namens Minute verliebt sich in Dustin, der eine ruhige Ausstrahlung mit gemeißelten Wangenknochen und einer soldatischen Anmutung verbindet, als hätte sich eine "bildschöne Militärhistorikerin von einem Gangsterboss schwängern lassen", wie es schön anschaulich, aber auch schön sinnfrei heißt. Die Lust am Grellen macht sich auch in dieser Geschichte geltend, in der es beim nächtlichen Bad im See zu einem regelrechten Wildschwein-Massaker kommt. Aber die zögerliche Annäherung der beiden jungen Männer bleibt im Kontrast dazu dezent gezeichnet, eine Verhaltenheit, die der Geschichte guttut und ihr eine funktionierende Spannungskurve verleiht.
Tiere kommen übrigens viel zu Schaden. Kranke Hunde, grausam zugerichtete Katzen, erschlagene Pfauen - das Motiv des kreatürlichen Leids verdichtet sich von Geschichte zu Geschichte. Es spiegelt die Fragilität der menschlichen Existenz, von der auch die Bevorzugten nicht verschont werden. So handelt die Erzählung "Schwarzach, St. Veit" von einer Frau, die von ihrer Schönheit lebt und als Model international Erfolg hat. Ihre glanzvolle Identität wird aber buchstäblich geschreddert auf der desaströsen Weihnachtsheimreise ins Alpendorf ihrer Eltern. Schönheit und Hässlichkeit werden zur Frage der Perspektive. Hier brilliert der katastrophische Erzählwitz der Autorin.
In den meisten Geschichten dominiert ein Lebensgefühl, das an einer Stelle auf eine knappe Formel gebracht wird: "Eine Mischung aus Langeweile und klirrender Verzweiflung." Dazu versteht sich Hegemann auf die Tricks der erzählerischen Coolness: dieses beiläufige Auskennertum, diese leicht überdrüssige Weltläufigkeit, kleine nadelspitze Gefühllosigkeiten, dazu ein paar Prisen Zeitgeist, etwa in Genderfragen. Und auf keinen Fall zu ambitioniert rüberkommen. Dazu verhelfen gewollte sprachliche Nachlässigkeiten und die gelegentlich beim Erzählen über die Schulter geworfenen Selbstkommentare: "Nebenbei bemerkt geht mir diese beschissene indirekte Rede auf den Keks. Ich lasse das jetzt."
Hier wird aber auch deutlich, dass Hegemann zu dekonstruktiv veranlagt ist, um das Erschaffen fiktiver Welten völlig ernst zu betreiben. Man hat den Eindruck, bei diesen Erzählungen wurden aus einer großen Menge von Entwürfen und Notizen die stärksten und coolsten Passagen zusammengeschnitten. An akribischer Plotarbeit und sorgfältiger Psychologie ist Hegemann dagegen wenig interessiert. Deshalb überzeugen ihre Figuren auch nicht als Charaktere. Eine gewisse, zum Bündel geschnürte Menge an schrillen Erlebnissen und schrägen Gedanken wird einfach als Figur deklariert. Weil die Strukturschwäche ihrer Geschichten offenkundig ist, hat Hegemann Gegenmaßnahmen ergriffen. Sie lässt Personal aus einer Geschichte in anderen wieder auftauchen, als wären allein durch Namensidentitäten schon Sinnzusammenhänge hergestellt. Und sie verlautbart in programmatischen Einschüben, dass das Leben eben nicht nach "Schema" verlaufe. Leser, die es gern etwas linearer und begründeter hätten, werden angepoltert: "Lesen Sie bitte weiterhin ihre amerikanische Sandkastenliteratur über dressierte Menschen mit dressierten Gefühlen, Ablenkungsmanöver, mit denen man das Kulturbürgertum bei Laune hält, damit der Rest der Welt in Ruhe seine Waffengeschäfte abwickeln kann."
Das ist schwach und etwas gestrig räsoniert. Waffengeschäfte sind gerade ein heikles Thema, an dem die Schwarz-WeißMoral Schiffbruch erleidet. Davon abgesehen ist auch in Hegemanns Geschichten viel mehr Artefakt und Dressur, als es dieser Stoßseufzer des Authentischen verbergen kann. Der Klappentext bewirbt die Erzählungen zwar als "Psychogramm unserer Gesellschaft". Mit dem größten Teil unserer Gesellschaft hat das (von materiellen Sorgen verschonte) Bohème-Milieu, das Hegemann in Szene setzt, aber wenig zu tun.
Eine langweilige Lektüre ist "Schlachtensee" jedoch nicht. Auch die schwachen Geschichten haben immer noch viele starke Sätze. Man liest sie für die Hegemann-Momente, für die knapp umrissenen Bilder und Szenen, für die lakonischen, leicht ins Absurde gedrehten Pointen. Ein Mensch müsse begreifen, heißt es in der Oligarchengeschichte, "dass er der Welt, in die man ihn hineingeboren hat, ein bisschen Unterhaltung schulde". Daran hat sich Helene Hegemann gehalten. WOLFGANG SCHNEIDER
Helene Hegemann: "Schlachtensee". Stories.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 272 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»[Hegemanns] Hinwendung zu den menschlichen Abgründen [entwickelt] eine ungeahnte Sogwirkung, der sich nur schwer zu entziehen ist.« Vogue 20220813