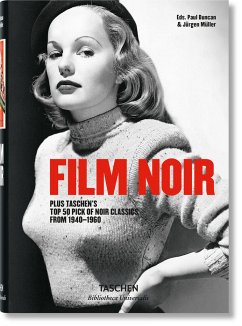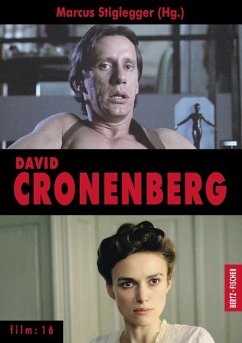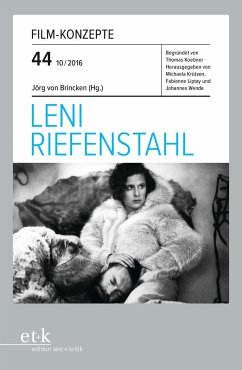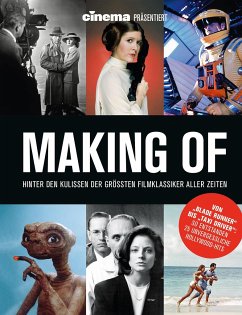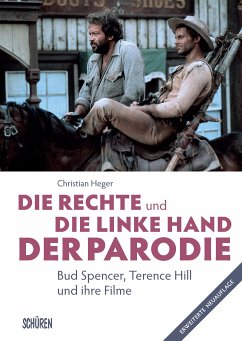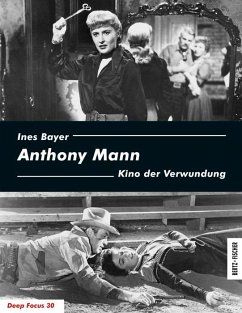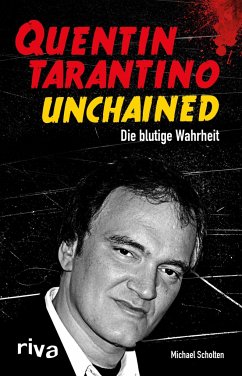Dominik Graf
Broschiertes Buch
Schläft ein Lied in allen Dingen
Texte zum Film
Herausgegeben: Althen, Michael

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Mit einem Vorwort von Michael Althen
Dominik Graf, geb. 1952 in München, 1974-1979 Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. Für seine Arbeit als Drehbuchautor und Filmregisseur (u. a. 'Die Katze' 1987, 'Die Sieger' 1994, 'München - Geheimnisse einer Stadt' 2000, 'Der Felsen' 2002, 'Hotte im Paradies' 2002, 'Der Rote Kakadu' 2005, 'Deutschland 09' 2009) wurde er u. a. mit dem Deutschen Fernsehpreis und insgesamt siebenmal mit dem Adolf-Grimme-Preis prämiert. Seine mehrteilige Serie 'Im Angesicht des Verbrechens' wurde 2010 auf der Berlinale in der Sektion Forum vorgestellt.
Produktdetails
- Verlag: Alexander Verlag
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 376
- Altersempfehlung: ab 14 Jahre
- Erscheinungstermin: Oktober 2009
- Deutsch
- Abmessung: 200mm x 131mm x 28mm
- Gewicht: 398g
- ISBN-13: 9783895812101
- ISBN-10: 3895812102
- Artikelnr.: 26359481
Herstellerkennzeichnung
Alexander Verlag Berlin
Fredericiastrasse 8
14050 Berlin
vertrieb@alexander-verlag.com
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Das perfekte Filmbuch hat Tobias Kniebe in Dominik Grafs "Schläft ein Lied in allen Dingen" entdeckt, denn er findet darin alles was er für wichtig hält: Leidenschaft, Analysefähigkeit, kritische Urteilsfähigkeit. Dass man mit diesem Buch aber auch noch eine Art Selbstporträt des Filmemachers Graf in den Händen hat, kann die Freude des Rezensenten nur vergrößern. Auf Sympathie stößt auch Grafs Augenmerk auf Nebenfiguren, Außenseiter und Vergessene der Filmgeschichte. Nur vor einem meint Kniebe den Autor warnen zu müssen, dass er sich nämlich in seinem "brennenden Abgrenzungsbedarf" an den falschen Gegnern abarbeitet und Gefahr läuft, sich als Filmregisseur "ex negativo zu definieren". Also immer schön locker bleiben, gibt der Rezensent dem Autor auf den Weg, dessen Buch ihn aber dennoch, wie es scheint, beeindruckt hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für