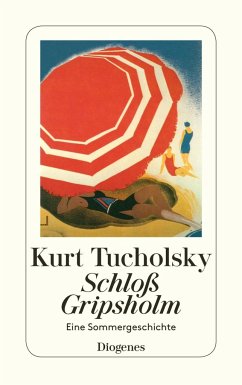Reine Schönheit ist Hans Traxlers Sache nicht. Der Veteran der Neuen Frankfurter Schule hat Kurt Tucholskys Roman "Schloß Gripsholm" höchst vergnüglich illustriert.
Als Kurt Tucholsky 1931 seinen Roman "Schloß Gripsholm" veröffentlichte, war Hans Traxler zwei Jahre alt - Buch und Illustrator gehören also einer Generation an. Das merkt man wohltuend am Resultat ihrer jüngsten Begegnung: Hans Traxler, der Veteran der Neuen Frankfurter Schule, hat für die Büchergilde Gutenberg "Schloß Gripsholm" illustriert. Und was ihm das für ein Vergnügen bereitet haben muss, ist bei jeder der siebenundfünfzig Abbildungen zu spüren, auch daran, dass der Ich-Erzähler nicht nur Tucholskys Züge trägt (es handelt sich bei dem Roman ja um eine autobiographische Fiktion), sondern subtil bisweilen an Hans Traxlers Äußeres denken lässt. Obwohl der Zeichner nicht raucht.
Über den Roman muss man nicht viele Worte verlieren, er ist Tucholskys erfolgreichstes Buch und stilistisch auch sein gewagtestes - vom postmodern anmutenden Auftakt, in dem Ernst Rowohlt und der Autor in einem kleinen brieflichen Machtspiel zwischen Verleger und Schriftsteller die Abfassung dieses Romans verabreden, bis zu den frivolen Passagen im schwedischen Urlaubsdomizil, in denen Tucholsky eine muntere ménage à trois so sozialverträglich engagiert verkleidet, dass man sich über die erotische Komponente keine anderen als romantische Gedanken macht.
Reine Schönheit aber ist Hans Traxlers Sache nicht. Die von ihm elegant gezeichneten Figuren - Kurt erst nur in Begleitung von Lydia, dann auch von Billie - stecken zwar in wunderschönen zeittypischen Gewändern, doch Traxler hat keine Scheu, zu den elegischen Illustrationen, die sich vor Schärenküsten und Sonnenuntergängen abspielen, auch satirische Bildfindungen zu gesellen. Wenn zum Beispiel Frau Adriani, die böse Internatsdirektorin, von Tucholsky so beschrieben wird: "Sie begann zu weinen. Die Prinzessin starrte sie an, als hätte sie ein exotisches Fabeltier vor sich", dann zeichnet Traxler die von ihm zuvor massig inszenierte Dame als bitter flennendes Krokodil und nimmt damit nicht nur Tucholskys Allegorie, sondern auch den zoologischen Topos der Krokodilstränen auf.
Auf solche Weise ergänzt der Zeichner die Charakterschilderungen im Buch, die bewusst nicht zu tief geraten sollen, weil ja das Ziel der ganzen Handlung nur die Erstellung jener "kleinen Sommergeschichte" ist, auf die Rowohlt und Tucholsky sich im ersten Kapitel geeinigt haben. Dass unter der Hand viel mehr in "Schloß Gripsholm" steckt, nämlich ein Zeiten- und Sittenbild der Weimarer Republik, merkt jeder Leser. Und Hans Traxler zeigt es.
Auch buchgestalterisch ist viel Überlegung in diese illustrierte (und in bewährter Rechtschreibung gesetzte) Ausgabe geflossen. Zwei Bilder werden auf Doppelseiten inszeniert, aber erst spät im Buch, so dass die Überraschung besonders groß ist. Zwei andere Illustrationen setzen sich von der Seitenvorder- auf deren Rückseiten fort - beides Darstellungen von Menschenreihen, deren eigentliche Pointen aus dem Aha-Erlebnis beim Umblättern entstehen.
"Vieles habe ich von dieser Stunde vergessen", berichtet der scheindiskrete Erzähler von einer Nacht im Gästezimmer des Schlosses, "aber eins weiß ich noch heute: Wir liebten uns am meisten mit den Augen." Unsere lieben auch: Hans Traxlers Bilder.
ANDREAS PLATTHAUS
Kurt Tucholsky: "Schloß Gripsholm". Eine Sommergeschichte.
Mit Bildern von Hans Traxler. Edition Büchergilde, Frankfurt am Main 2011. 176 S., 57 Abb., geb., 24,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Kurt Tucholsky hat seinen Platz im Pantheon der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts.« Marcel Reich-Ranicki