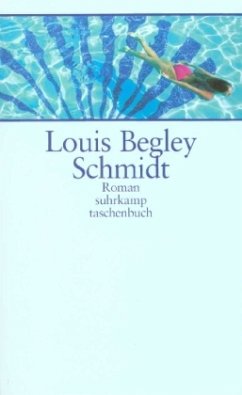Louis Begley erzählt hier die Geschichte einer Lebenskrise und deren Überwindung durch die Liebe. Sein Held ist der zwangsweise frühpensionierte, vor nicht langer Zeit noch hochangesehene New Yorker Anwalt Albert Schmidt, ein Don Juan mit rigiden Prinzipien, dem der Ruhestand allmählich zum Alptraum wird. Ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau eröffnet ihm seine Tochter Charlotte, daß sie heiraten werde, und zwar ausgerechnet Jon Riker - den ehrgeizigen, habgierigen Anwalt und Kanzleikollegen Schmidts, dem er nicht zuletzt die Kürzung seiner Pension zu verdanken hat. Schmidt wendet sich gegen die Eheschließung und verstärkt damit nur die Geschwindigkeit, mit der sich seine Tochter von ihm entfernt. Charlotte fordert schließlich vorab ihr Erbteil. Schmidts Weg in die Einsamkeit und Verbitterung scheint unausweichlich vorbestimmt, gäbe es da nicht die junge puertoricanische Kellnerin Carie, die ihn mit allen Sinnen liebt und sein Leben von Grund auf verändert.

Louis Begleys neuer Roman "Schmidt" · Von Harald Hartung
Nein, Louis Begleys neuer Roman hat nichts Sensationelles. Er ist das diskreteste seiner bisherigen Bücher. Dagegen spricht auch nicht, daß Gianni Versaces Mörder darin kurz vor seinem Tod gelesen haben mag. Die Sensation, freilich eine, die sich immer noch nicht ganz herumgesprochen hat, ist Begley selbst.
Anders als John Updike, sein Kommilitone in Harvard, kam Louis Begley erst spät zum Schreiben. Der erfolgreiche Anwalt und Teilhaber einer renommierten New Yorker Kanzlei ließ sich 1990 siebenundfünfzigjährig für vier Monate beurlauben, um seinen ersten Roman zu schreiben. "Lügen in Zeiten des Krieges" beschreibt neben allen Schrecken die Kraft der lebensrettenden Fiktion. Mit der Erfindung seiner Kindheit aber war Begleys Schreibimpuls nicht erschöpft, wie die Romane "Der Mann, der zu spät kam" und "Wie Max es sah" zeigten.
Begley mag sich im Establishment fremd fühlen, aber er kennt diese Welt in- und auswendig. Er scheut auch das Mondäne nicht, wenn es ihm doppelbödig erscheint. Er verfügt über eine Weltläufigkeit, wie sie gegenwärtig keinem deutschen Erzähler zur Verfügung stehen dürfte. Dabei gibt er sich bescheiden als ein Mann, auf dessen Schulter ein kleiner Affe sitzt, der "ganz andere Dinge" sieht als der Anwalt.
Dieser Affe der einfühlenden Mimesis muß ihm den Ehrgeiz eingegeben haben, nach den virtuosen Kompositionen nun einen ganz einfachen Stoff zu behandeln. Etwas Einfaches, das schwer zu machen ist. Etwas "About Schmidt", wie es sachlich heißt. Was die deutsche, wiederum von Christa Krüger präzis übersetzte Version noch weiter zu "Schmidt" verkürzt.
"Schmidts Frau war kaum sechs Monate tot, da eröffnete ihm sein einziges Kind Charlotte, sie werde heiraten." So die knappe und scheinbar simple Exposition. Albert Schmidt, der sich gern Schmidtie nennen läßt, ist ein hochangesehener New Yorker Anwalt, der sich nach dem Tod seiner Frau vorzeitig hat pensionieren lassen. Er tut das auch in dem Wissen, daß die Eigenschaften, die seine Mandanten an ihm schätzten, inzwischen aus der Mode gekommen sind. Der Sechzigjährige, der immer noch um seine Frau Mary trauert, bereitet sich auf einen ruhigen Lebensabend vor. Der Zeitpunkt scheint gut gewählt, er wird seinen Lebensstandard (auch wenn ihn die Kurse seiner Papiere beunruhigen) nicht sehr einschränken müssen. Da trifft ihn die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit auf eine Weise, die nach und nach sein ganzes Leben verändert.
Charlotte, die schon länger mit Jon Riker zusammenlebt, den er selbst in die Praxis geholt hat, will das Verhältnis legalisieren. Aber Schmidt, anstatt sich zu freuen, fühlt sich in einen Strudel von Widerständen und Aversionen gezogen. Ein Schwiegersohn, so meint er mit einem arabischen Sprichwort, "ist wie ein Kiesel, nur schlimmer, weil man ihn nicht aus dem Schuh schütteln kann".
Schmidt schüttelt, wenn auch überwiegend im Geiste. Ist Jon Riker nicht ein Fachidiot, ein bornierter Streber? Dazu einer, dem Schmidt offenbar die Kürzung seiner Pension zuzuschreiben hat? Und ist er nicht Jude? Seiner Frau einer Verlagslektorin hätte er mit diesem Argument nicht kommen dürfen. Sie hätte, wie er meint, alle Sünden Hitlers auf sein Haupt versammelt. Doch nun läßt Schmidt seinem Antisemitismus freien Lauf immerhin so weit, daß sein guter Freund Gil, der Filmregisseur, ihn darauf aufmerksam machen muß, daß er mit einem Juden redet. Unfair findet er, wie Charlotte ihn an den alten Standardwitz in der Kanzlei erinnert, der sich um "Schmidts Endkampf gegen Zion" drehte. Ohnehin nimmt er ihr nicht ab, daß sie ihre "Tabakkampagne" im Dienst der Zigarettenindustrie betreibt und zugleich zum Judentum konvertieren will.
Das Merkwürdige ist nun, daß Begley diesen mal pedantischen, mal larmoyanten Frührentner mit erkennbarer Sympathie zeichnet und die jungen Leute nun ja, als die tüchtigen Karrieristen, die sie sind. Der Erzähler hält sich ganz nah an seinen Helden, spricht oft wie sein Bauchredner. Sollte es daran liegen, daß wir auch in diesem Roman eine Figur vom Geist und Fleisch des Autors vor uns haben zumindest von seiner Skepsis? Und sollte Begley noch etwas Besonderes mit ihr vorhaben?
Ja, denn er führt Schmidt zum späten Glück. Wenn es nicht ohne Katharsis abgeht, so bleibt es doch bei einer merkwürdig milden Reinigung. Wir erfahren nicht einmal, ob sie überhaupt eine Vorbedingung war. Einmal gibt es am Strand die Versuchung zum Selbstmord ähnlich wie für Ben in "Der Mann, der zu spät kam". Schmidt beläßt es bei der bloßen Vorstellung, einer Szene "aus dem Woody-Allen-Film, der aussah, als hätte Bergman ihn gedreht". Doch im Salon einer veritablen Analytikerin, die freilich die zukünftige Schwiegermutter seiner Tochter ist und attraktiv dazu, beichtet Schmidt immerhin seine Fixierung an die geizige Mutter und sein erotisches Doppelleben: den Donjuanismus der Hotelnächte auf seinen Geschäftsreisen. Kurzum, die Hürde zum Glück ist nicht allzu hoch.
Schmidtie nimmt sie mit Hilfe von Carrie, einer puertoricanischen Kellnerin, die jünger ist als seine Tochter. Sie liebt ihn, den alten Mann, selbstlos und hingebend. Aber wohl auch, weil sie ein anderer alter Mann, der jetzt völlig heruntergekommen ist und Schmidt auflauert, in die Liebe eingeführt hat. Noch ein anderes Problem verhindert, daß das Glück übergroß werden kann: Bryan, so etwas wie Carries Beschützer, den sie nun im Schmidtie-Glück nicht fallenlassen will.
Schmidt verbucht das alles positiv: "Plötzlich sah er eine Seite seines arbeitslosen, vereinsamten Lebens, die er vorher nie bedacht und schon gar nicht begriffen hat: Er war frei!" Er bleibt es auch bis ans Ende des Romans. Er bleibt frei, obwohl er im Nebel jenen (betrunkenen) Penner überfährt, den wir bereits kennen. Und sollten sich irgendwann Probleme mit Carrie und Bryan oder mit Charlotte und Jon ergeben sie wollen Schmidtie ausbeuten, indem sie vorgeben, ihn davor schützen zu wollen , er ist, vorläufig wenigstens, gegen alles gefeit: denn seine plötzlich verstorbene Stiefmutter Bonnie hat ihn zum Erben über ihr gesamtes, offenbar durchaus erkleckliches Vermögen eingesetzt. Schon denkt Schmidt an ein großes Haus in Florida, um das sich Bryan kümmern wird Bryan als sein Pfleger. Das wäre ein neuer Roman aber ihn erzählt Begley nicht mehr. Er könnte ja schlimm ausgehen.
Wir befinden uns im Märchen. In einem guten und zugleich ziemlich bösen. Es gibt Tapetentüren, aus denen der steinerne Gast treten könnte. Schmidt hat in seinen gelegentlichen Anwandlungen von Bedrückung das Bedürfnis, zu büßen, zu sühnen. Da erinnert er sich, seiner Frau und der achtjährigen Charlotte Langspielplatten von Don Giovanni vorgespielt zu haben, und fragt sich: "Wie soll er, Schmidt, gerettet werden? Indem er von Carrie läßt? Sei pazzo! Um nichts in der Welt!"
Tatsächlich verlangt ihm das Leben keinen Bußpreis ab oder besser: der Autor als Agent des Lebens. Dürfen wir den milden, den eher gedankenlosen Antisemiten Schmidtie mit Rührung entlassen, weil wir dem alten Mann sein spätes Glück gönnen? Oder haben wir eine Satire vor uns, deren Widerhaken wir zu spät verspüren? Begley ist ein Moralist, der sich hinter Flaubertscher Impassibilité verbirgt. Er zeigt nicht mit dem Finger, ist weder Staatsanwalt noch Richter. Er führt uns nur manchmal an Stellen, an denen der Boden nachzugeben scheint. Da ergreift uns ein leiser metaphysischer Schwindel, aber was der mit Schuld und Sühne zu tun hat, bleibt offen. Wo der Mord fehlt, erscheint der Komtur nicht; zumal bei jemandem, bei dem es zum Don Juan nicht reichte.
Begley, der Virtuose der Aussparungen, der Ellipsen, übt auch in seinem neuen Roman die Kunst des Kunstlosen. Er macht uns alltägliche Umstände, geschäftliche Verhandlungen, familiäre Intrigen spannend und rückt uns einen nicht unintelligenten, nicht unsensiblen, doch ziemlich durchschnittlichen Helden irritierend nahe. Wir lesen "Schmidt" und sind Schmidt, träumen wie Schmidt. Daher gibt uns der hintersinnige Zauberer das Märchen dazu. Er schüttelt es aus einem Ärmel, in dem noch viele Geschichten stecken dürften.
Louis Begley: "Schmidt". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christa Krüger. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997. 311 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Louis Begley ist ein Meister des philosophischen Romans in der Mimikry beiläufiger Plauderei.« Ulrich Greiner DIE ZEIT
"Indem er in einer feinen Form schreibt, erlangt Begley in diesem ebenso scharfen wie eleganten Buch eine außergewöhnliche Balance. ... Nachdem er in seinen früheren Werken Außenseiter porträtiert hat, macht er sich nun an den absoluten Insider, den er mit Würde und Verständnis behandelt."