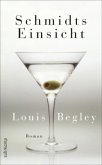Da ist er wieder: der pensionierte New Yorker Anwalt Albert Schmidt, ein Don Juan mit Prinzipien. Vor der Einsamkeit durch seine Liebe mit der jungen Puertoricanerin Carrie bewahrt, führt Schmidt mit ihr ein abgeschiedenes Leben. Das erste Mal seit dem Tod seiner Frau ist Schmidt glücklich. Nur die Zukunft mit Carrie bereitet ihm Sorgen, denn die Schöne weist all seine Heiratsanträge zurück. Schmidts Befürchtungen bewahrheiten sich - Carrie verliebt sich in einen anderen Mann. Schlimmer noch: Schmidts Tochter Charlotte fordert Geld. Sie hat ihren Ehemann, Schmidts ehemaligen Protegé Jon Riker, verlassen. In seiner Verwirrung findet Schmidt einen ungewöhnlichen Verbündeten, einen geheimnisvollen Ägypter, der ihm ein verlockendes Angebot macht. Schmidts Bewährung ist eine staunenswert leichte Geschichte darüber, wie schwer es ist, die Entfernung von Mensch zu Mensch zu überwinden - selbst wenn man liebt. Ein Roman über die Illusionen der Jugend und die Weisheit des Alters - undumgekehrt.

Louis Begley erlöst Schmidtie · Von Hubert Spiegel
Arbeitseifer ist, wenn wir die Romane Louis Begleys recht verstanden haben, die Folge einer weitverbreiteten Unfähigkeit zum Glücklichsein. Fleiß, so müssen wir mit diesem Autor annehmen, verdankt sich der völligen Abwesenheit dessen, was man gemeinhin unter einem erfüllten Leben versteht. Erfolg, so schließen wir mit seinen Helden, ist nichts weiter als eine künstliche Substanz höchst zweifelhafter Provenienz, die man in seelische Hohlräume fließen läßt. Dort geht sie auf wie Hefeteig in der Nachmittagssonne, füllt die innere Leere aus und betäubt auf angenehmste Weise jene Verzweiflung, die uns unweigerlich überfällt, wenn wir den Dingen ins Gesicht sehen. So ist das Leben. Trostlos? Nun ja, aber es lassen sich großartige Romane darüber schreiben.
Einer davon ist "Schmidts Bewährung", das jüngste, nunmehr sechste Buch Louis Begleys. Vor vier Jahren schilderte der angesehene New Yorker Anwalt und Schriftsteller Begley in "Schmidt", wie der angesehene New Yorker Anwalt und Frühpensionär Albert Schmidt sich nach dem Tod seiner Frau aus der Stadt zurückzog, seine Trauer sowie Haus und Garten im noblen Bridgehampton auf Long Island pflegte, mit seiner Tochter Charlotte in einen häßlichen Streit geriet, gegen Einsamkeit und aufsteigende Depressionen ankämpfte und schließlich mit der vierzig Jahre jüngeren Kellnerin Carrie ein spätes Glück fand, das so unwahrscheinlich war, daß es dem Leser ähnlich ging wie Schmidts Tochter: beide wurden von Zweifel geplagt. Charlotte mißtraute der Lauterkeit von Carries Gefühlen und der Leser dem Feingefühl des Autors. Während Charlotte sich dafür entschied, die Gespielin des Vaters als raffiniertes, geldgieriges Flittchen abzutun, blieb mancher Leser unentschieden. Carrie war so eindeutig eine Altherrenphantasie, daß bei einem Autor von der Subtilität Begleys eine Absicht dahintergesteckt haben muß. Aber welche?
Am Ende des Romans hatte Schmidtie, wie er sich gern nennen läßt, ein arroganter, antisemitischer, zum Selbstmitleid neigender Geizhals von bemerkenswertem Egoismus, eine herzensgute, allzeit bereite Bettgefährtin von Anmut, Schönheit, Witz und Herzensgüte errungen, seine beiden Nebenbuhler mehr oder weniger elegant abserviert und überdies noch eine Erbschaft gemacht, die ihm erlaubte, den ohnehin finanziell unbeschwerten Lebensabend noch üppiger mit dem Blattgold des noblen Müßiggangs auszuschmücken.
Das klingt nach einem Groschenroman für abfindungsgestärkte Vorruheständler, aber das eigentlich Märchenhafte an diesem Buch war der Umstand, daß man es wohl nicht lesen konnte, ohne eine gewisse Sympathie für seinen Helden zu hegen, eine Empfindung, die mindestens ebenso gegen jede Wahrscheinlichkeit verstieß wie Schmidts späte Liaison. Man legte das Buch aus der Hand und dachte: Schmidtie, das glaubst du doch selbst nicht.
Nun, vier Jahre später, kehrt Schmidt zurück, und siehe da, er glaubt es tatsächlich nicht. Nicht mehr. Im Roman sind zwei Jahre vergangen, die Schmidt und Carrie offenbar überwiegend im Bett verbracht haben. Der Ruheständler ist der glücklichste Mensch auf Erden, zumindest der glücklichste alte Knacker mit einer rassigen Geliebten, die jünger ist als seine Tochter. Nichts trübt dieses Glück, außer einigen Kleinigkeiten. Sie reichen aus, um Schmidt zur Verzweiflung zu treiben: Das ungleiche Paar ist gesellschaftlich isoliert und lebt so zurückgezogen, daß Carrie sich über kurz oder lang zu Tode langweilen muß; zumal auch Schmidties Potenz bedenklich nachgelassen hat. Die dunkle Ahnung, Carrie könne ihn, der nun auf die Siebzig zugeht, eines nicht mehr allzu fernen Tages doch verlassen, läßt sich kaum noch verscheuchen, neue Nebenbuhler tauchen auf, der eine blutjung, der andere noch reicher, unvergleichlich viel reicher als Schmidt selbst. Es handelt sich um den Milliardär Michael Mansour und Jason, einen von Mansours Leibwächtern. Überdies hat sich die Ehe seiner Tochter mit seinem ehemaligen Anwaltskollegen Jon Riker, gegen die Schmidt im vorigen Roman vergeblich zu Felde gezogen war, als Desaster erwiesen.
Und nun fordert Charlotte von ihrem Vater, das einzige, was sie immer zuverlässig von ihm bekommen hat: Geld. Jenes Geld, das er jetzt zurückhalten will, weil er seine Schulden bei seiner Tochter in anderen Währungen begleichen möchte. Liebe, Zuneigung, Geborgenheit, guter Rat und moralische Unterstützung hält Schmidt im Übermaß bereit. Nichts davon kann Charlottes Interesse erregen. So unglaubwürdig Begley die süße Carrie schildert, so glaubwürdig zeichnet er die herbe Charlotte als lebenslänglich vernachlässigte Tochter: enttäuscht, verbittert und ihrem Vater nur noch durch zwei Dinge verbunden, die Aussicht auf das Erbe und auf Rache.
Es ist kein leichtes Schicksal, das Begley seinem Helden in diesem zweiten Roman beschert. Am Ende, als nach mancher Demütigung die Geliebte verloren ist, ihr Kind, das womöglich seines sein könnte, einen anderen zum Vater haben wird und das Experiment Ruhestand auf ganzer Linie gescheitert ist, sehen wir Schmidt am Scheideweg. Er hat Mansours Angebot, die Stiftung des Milliardärs zu leiten, angenommen, er arbeitet und reist wieder. Vor ihm, in einem Pariser Hauseingang, blinkt ein poliertes Messingschild, er muß nur den Klingelknopf drücken, und eine Tür wird sich öffnen, hinter der die Witwe eines jüngeren Arbeitskollegen ihn zum Tee erwartet. Vor dieser Tür läßt Louis Begley seinen Helden und seine Leser zurück, den einen unentschlossen, ob er klingeln soll, die anderen unsicher darüber, ob mit diesem offenen Ende ein weiterer, ein dritter Schmidt-Roman angekündigt werden soll.
Manches spricht dafür, denn es ist offensichtlich, daß Begley mit dem weltläufigen und in sich verkapselten Schmidt eine Figur gefunden hat, deren Seelenleben ihn fasziniert und die außerdem bestens geeignet ist, die Abrechnung mit jener Welt zu betreiben, die Begley seit seinem zweiten Roman "Der Mann, der zu spät kam" in verschiedenen Varianten beschrieben hat.
Es ist das Milieu des Ostküsten-Patriziats mit seinen guten Manieren und falschen Freundlichkeiten, den bezaubernden Sommerhäusern auf Long Island und den austauschbaren Erinnerungen an London, Paris, Florenz und Venedig. In diesem gut gepolsterten Mikrokosmos herrscht eine Ordnung, die zwar altbacken anmutet, aber noch recht gut funktioniert. Während in der klassenlosen Gesellschaft überkommene Werte keinen Pfifferling mehr wert sind, paßt hier noch alles aufs schönste zusammen: die Frau zum Mann, der Mann zum Job, das Einstecktuch zum Blazer. Eine Welt, festgefügt aus Konventionen, zusammengehalten von einem ganz besonderen Kitt, dem Geld. In diesen Sphären fungiert Geld als eine Art Universalkleber, der Verbindungen jeglicher Art zustande bringt und auch Menschen so eng aneinanderzuschweißen vermag, daß kein Blatt mehr zwischen sie paßt, es sei denn, es handelte sich um eine Banknote - was Geld zusammengeführt hat, kann Geld auch wieder lösen.
In dieser durch und durch materialistischen Welt macht Albert Schmidt eine seltsame Figur: überangepaßt, aber mit einem Schuß Nonkonformismus versehen, eigenbrötlerisch, arrogant, überheblich und zugleich sensibel und verletzlich. Schmidt ist auf bemitleidenswerte Weise angewiesen auf die Konventionen, deren Hohlheit er natürlich durchschaut. Er gleicht einer Schildkröte, die sich dafür verachtet, daß sie ohne ihren Panzer nicht leben kann und weiß, wie verloren und lächerlich sie ohne seinen Schutz aussehen würde. Begley schildert diese Welt aus ungewöhnlicher Perspektive: Wir erblicken den Schildkrötenpanzer von innen. Was wir sehen, die Kanzlei, Long Island, Carrie, Charlotte, die jüdische Familie der Rikers, den einzigen Freund Gil, den obskuren Mansour, sehen wir allein durch Schmidts Augen. Er ist ein glänzender, aber nicht immer zuverlässiger Beobachter.
Nimmt man beide Schmidt-Romane zusammen, werden wir zu Zeugen einer Revision und eines zähen Kampfes: Albert Schmidt zieht Bilanz, unterzieht Freundschaften, Karriere, Familienleben einer Prüfung und kämpft um das Leben, das er nie geführt hat, weil er es nie führen konnte. Statt dessen war er eifrig, fleißig, erfolgreich. Und weil dies das einzige ist, was er sein konnte und sein kann, läßt Begley "Schmidts Bewährung" mit der Rückkehr seines Helden in das Arbeitsleben enden, mit der Flucht in die alte Welt. Am Anfang ist Schmidts neues Leben, das Leben eines reichen Witwers im Ruhestand, eine leere Leinwand. Am Ende weiß Schmidt, daß die Farben auf seiner Palette schon vor vielen Jahren eingetrocknet sind.
Wie bitter dieses Ende ist, zeigt der amerikanische Originaltitel böser, aber auch besser als die deutsche Übersetzung. "Schmidt delivered" spricht von einem befreiten oder erlösten Helden. Aber befreit wovon, wenn nicht von der Last seiner Gefühle, auf die er sich zu spät verpflichten wollte? Schmidts Erlösung ist seine größte Niederlage.
Louis Begley; "Schmidts Bewährung." Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christa Krüger. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 311 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main