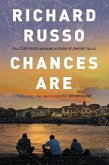Vor der Kulisse der großen norddeutschen Schneekatastrophe um die Jahreswende 1978/79 erzählt Jan Christophersen eine packende Familiengeschichte. Darin schafft er unvergessliche Figuren und entwirft das beeindruckende Bild einer rauen Gegend voller Wasser, Sand und Schnee. Er erzählt von der Suche nach Identität in einer Familie, in der das Schweigen den Weg zueinander zu einer langen Reise werden lässt - atmosphärisch dicht, mit leisem Witz und einer kraftvollen, suggestiven Sprache.Ausgezeichnet mit dem Debütpreis des Buddenbrookhauses und nominiert für den Franz-Tumler-Preis

Grog im Grenzkrug, Möwenschiet im Watt: Jan Christophersen hat mit dem Roman "Schneetage" ein friesisch herbes Debüt vorgelegt.
Von Martin Halter
Gott züchtigt die Hochmütigen und belohnt die Bescheidenen. Rungholt, das Sodom im Wattenmeer, dessen frevlerische Hybris Detlev von Liliencron in seiner Ballade "Trutz, Blanke Hans" und Juliane Werding in ihrem Lied "Ruhe vor dem Sturm" besungen haben, versank 1362 in einer Sturmflut. Schatzgräber und Sensationsreporter, Heimatforscher, Archäologen und der Ethnologe Hans-Peter Duerr suchen seit hundert Jahren nach Überresten des deutschen Atlantis, aber erst Jan Christophersen hat in seinem Romandebüt die graue Stadt im Meer gefunden. Wo so leise und bedächtig Heimat- und Familiengeschichten von wortkargen Friesen erzählt werden, wo Vergangenheit und Gegenwart, Wattenmeer und Welt so zuverlässig wie Ebbe und Flut hin- und herschwappen, kann eigentlich nichts mehr untergehen.
Paul Tamm ist ein Otto Normalverbraucher zwischen Stunde null und Wirtschaftswunder. Der Kriegsheimkehrer ohne Heimat, gestrandet im (fiktiven) deutsch-dänischen Grenzort Vidtoft, heiratet die Wirtin des Dorfkrugs und krempelt die Ärmel hoch. Aber er ist nicht robust genug für Schlussstriche und Wiederaufbau, und so driftet er, kaum von irgendwoher an Land gespült, auch schon wieder weg in Nebel, Regen und Schnee. Sein "Generalplan Grenzkrug", ein zaghafter Versuch, Touristen anzulocken, verläuft im Sande: Nur ein Kunstmaler, der - eine kollegiale Verbeugung vor Siegfried Lenz' "Deutschstunde" - von ferne um das Haus des verehrten Kollegen Nolde in Seebüll streicht, quartiert sich als Stammgast ein. Paul kränkelt und zieht sich immer weiter aus Familie, Krug und Dorf in die innere Emigration zurück. Begleitet vom grimmigen Kopfschütteln seiner Frau und seinem Ziehsohn, dem Erzähler Jannis, verbeißt sich der einsame Eigenbrötler mehr und mehr in seine "Mission": die Suche nach dem mythischen Rungholt. Eine hölzerne Okarina-Flöte, Auerochsenschädel, die Scherbe einer mutmaßlichen Kirchenglocke: Was er dem Meer entreißt, was er an Zuschreibungen, Datierungen, Legenden und Phantasien zu Papier bringt, stößt bei den Landesarchäologen allenfalls auf höfliches Interesse. Aber das kümmert den Sonderling wenig: "Warum finden, wenn man auch suchen kann?" Paul will nicht der Schliemann von Rungholt werden, nur den schwankenden Boden ergründen und womöglich festigen, auf dem er steht. Auch wenn ihm dabei seine Ehe, seine Kinder und sein Leben wie Sand und Schlick durch die Finger rinnen.
Wenn Menschen einsam, mundfaul und unterkühlt im Nebel durchs Watt stapfen, verschwimmen die Konturen naturgemäß. Paul, der somnambule Träumer, hat noch die schärfsten Umrisse; aber Figuren wie der Kunstmaler, die Wirtin und ihre Gäste und selbst Jannis sind kaum mehr als blasse Schattenrisse: Zart und schön, aber doch mehr grau in grau als bunt dahingetuschte Nolde-Aquarelle. Nicht nur, weil ihre Herkunft und ihr Wesen im Dunkeln bleiben: Christophersen verweigert jede Auflösung der subtilen Spannungen und unausgesprochenen Dramen. Alle, so viel steht fest, sind "Gestrandete des Nordens": Flüchtlinge, Touristen, Außenseiter, die sich nach Nestwärme und heißem Tee sehnen und doch nicht so recht Wurzeln im friesischen Boden schlagen können. Selbst Jannis, Sohn eines in den letzten Kriegstagen abgeschossenen britischen Bomberpiloten, der auf der Hallig Südfall Unterschlupf fand, bleibt bis zuletzt, als sich im großen Hochzeits- und Schneetreiben der Silvesternacht 1978/ 79 die Katastrophe der "Ersten Großen Mandränke" zu wiederholen scheint, trotz aller Sesshaftigkeit und Heimatliebe ein fremdes Findelkind. Still läuft er neben seinem Ziehvater her und stellt keine Fragen; erst ganz am Ende macht er sich eher widerstrebend auf, seinen leiblichen Vater in Schottland zu suchen.
Warum in der Ferne finden, wenn man auch in der Nähe suchen kann? Paul lehrte sein Mündel, wie man aus Scherben und Spuren, einer verlassenen Deichlinie hier und Brunnenresten da eine untergegangene Welt rekonstruiert. So wie er, immer nur seinem inneren Kompass folgend, durch Matsch- und Marschland wanderte, unscheinbare Bruchstücke einer großen Geschichte auflas und in seinem privaten Rungholt-Museum aufbewahrte, geht auch der Erzähler vor. Christophersen will ausbuddeln und sammeln, was zur Heimatgeschichte gehört, bevor es die nächste Flut wegspülen, die nächste Schneekatastrophe zudecken kann: Kindheitserinnerungen und weite Horizonte, Möwenschiet und stimmungsvolle Landschaften, Anekdoten und Schnurren über Schmuggler und Schwarzbrenner, die "Speckdänen" und die Hallig-Gräfin von Südfall, Heimatabende mit Grünkohl und den "Swinging Frisians", auch zahlreiche alte, kraftvolle Wörter wie Kaob, Ditten, Lahnung, Warft und Kimming. Man hört schlimme Geschichten von Russen, Flüchtlingen und Nazis, aber im Dorfkrug ist alles noch oder schon wieder an seinem Platz: Der Regen pladdert, die Sammelschiffchen der Seenotretter sind komplett, der olle Steensen stopft seine Meerschaumpfeife, und Männer, die in Gummistiefeln sterben und Tade Karff, Harro Knutzen oder Piet Philippsen heißen, lüften für ein herzhaftes "Moin" ihre Prinz-Heinrich-Mützen. "Der Holzofen in der Ecke bollerte und wärmte nach Kräften. Tee gab es zu trinken. Man saß, schlürfte aus den Bechern, schwieg und dachte nach."
Jan Christophersen lebt in Flensburg, aber die rauhe Nordsee liegt ihm näher als die Ostsee. Er ist 35 Jahre jung, schreibt aber eher wie Lenz oder Theodor Storm als wie ein Absolvent des Leipziger Literaturinstituts. Das ist kein Fehler, im Gegenteil; aber für süddeutsche Leser vielleicht doch ein wenig exotisch. Dieser sehr ruhige, friesisch herbe und weitgehend humorfreie Roman einer Heimat- und Vatersuche ist nichts für einen kurzen Sylt-Sommerurlaub. Man muss ihn an einem stillen Winterabend unterm Reetdach lesen, wenn draußen der Schneesturm tobt und drinnen am Kachelofen der Grog dampft: "Rum mutt, Szucker kann, Water bruukt nich."
Jan Christophersen: "Schneetage". Roman. mareverlag, Hamburg 2009. 366 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Das Spektakuläre, muss man nach der Lektüre von Martin Halters Rezension dieses Roman konstatieren, kommt in "Schneetage" ganz ausgesprochen gemächlich daher. Spektakulär nämlich könnte einem die Suche nach dem mythischen untergegangenen Rungolt, dem "Sodom im Wattenmeer", wohl scheinen, um die es dem Helden des Buchs, einem Mann names Paul Tamm, geht. Der landet nach dem zweiten Weltkrieg in einem deutsch-dänischen Grenzdorf und lebt dort und sucht Rungolt und findet es nicht. Davon erzählt Petersen derart norddeutsch und grau in grau, dass Halter sich geradezu an Theodor Storm oder Siegfried Lenz erinnert fühlt. Was aber eher als Kompliment denn als Absage gemeint ist. Ob allerdings auch die süddeutsche Leserschaft etwas damit anfangen könne - das weiß der Rezensent dann doch nicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH