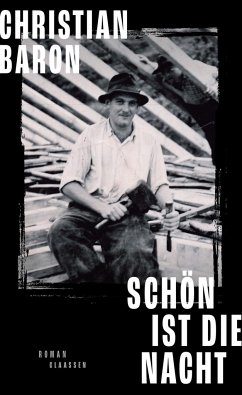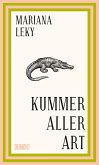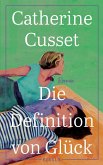Das Dröhnen und die Herrlichkeit, die Bürde und die Notwendigkeit des Lebens der "einfachen Leute"
Willy sehnt sich nach nichts so sehr wie nach einem normalen Leben. Er will seine Arbeit als Zimmerer gut machen, er will für seine Familie sorgen, er träumt vom eigenen Häuschen. Mit seiner ehrlichen Art stößt er immer wieder an Grenzen, was nichts an seinem Entschluss ändert, anständig zu bleiben.
Horst, ein ungelernter Hilfsarbeiter, glaubt schon lange nicht mehr daran, auf ehrliche Weise nach oben zu kommen. Er greift zu halbseidenen Mitteln, und seine Existenz entgleitet ihm in dem Maße, in dem er seine Aggressionen nicht im Griff hat. In die Spirale des Abstiegs zieht er seinen Freund Willy hinein - mit katastrophalen Folgen für beide.
Schön ist die Nacht ist ein Roman über die westdeutschen Siebzigerjahre, der Roman einer ganzen sozialen Klasse. Zwischen ihren nach Emanzipation strebenden Frauen und streikwilligen "Gastarbeitern", zwischen ihnen entgleitenden Kindern und sie unter Druck setzenden Chefs, zwischen Spekulantenträumen und Baustellenwirklichkeit führen Willy und Horst aussichtslose Kämpfe um ihren Anteil am Wohlstand. Müssen wir sie uns als glückliche Menschen vorstellen?
Willy sehnt sich nach nichts so sehr wie nach einem normalen Leben. Er will seine Arbeit als Zimmerer gut machen, er will für seine Familie sorgen, er träumt vom eigenen Häuschen. Mit seiner ehrlichen Art stößt er immer wieder an Grenzen, was nichts an seinem Entschluss ändert, anständig zu bleiben.
Horst, ein ungelernter Hilfsarbeiter, glaubt schon lange nicht mehr daran, auf ehrliche Weise nach oben zu kommen. Er greift zu halbseidenen Mitteln, und seine Existenz entgleitet ihm in dem Maße, in dem er seine Aggressionen nicht im Griff hat. In die Spirale des Abstiegs zieht er seinen Freund Willy hinein - mit katastrophalen Folgen für beide.
Schön ist die Nacht ist ein Roman über die westdeutschen Siebzigerjahre, der Roman einer ganzen sozialen Klasse. Zwischen ihren nach Emanzipation strebenden Frauen und streikwilligen "Gastarbeitern", zwischen ihnen entgleitenden Kindern und sie unter Druck setzenden Chefs, zwischen Spekulantenträumen und Baustellenwirklichkeit führen Willy und Horst aussichtslose Kämpfe um ihren Anteil am Wohlstand. Müssen wir sie uns als glückliche Menschen vorstellen?
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der zweite Teil von Christian Barons Pfälzer Familienchronik erzählt Rezensentin Lerke von Saalfeld zufolge genauso authentisch und wuchtig vom Elend des Arbeiterlebens in der Provinz wie der erste autobiografische Teil. Während Baron in diesem seine harte Kindheit in eben jenem Milieu schilderte, springt er nun zeitlich zurück und zeichnet die Lebensgeschichte seines Vaters nach, so Saalfeld. Die Erzählung dreht sich um jenen Horst Baron und seinen Jugendfreund Willy, die im Wirtschaftswunder-Deutschland der 70er Jahre daran scheitern, am Aufschwung teilzuhaben, berichtet die Kritikerin. Horst zieht den ehrlichen Willy in seine kriminellen Machenschaften hinein, in beider Familien herrschen Härte und enormes Leid. Baron zeichnet eine Welt ohne Ausweg, schreibt Saalfeld, geprägt von Armut und Gewalt. Dabei geht es ihm nicht um das Mitleid der Leser, sondern um die Offenlegung desaströser Verhältnisse, so die Rezensentin. Beeindruckt ist Saalfeld von der atmosphärischen Dichte und den authentischen Figuren und wartet schon gespannt auf den dritten Teil der "Lauterer Trilogie".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der Titel klingt wie Hohn, der Roman selbst ist die Wucht: Christian Barons "Schön ist die Nacht"
Die Pfälzer Familienchronik von Christian Baron befindet sich in Fortsetzung. 2020 erschien sein Debüt "Ein Mann seiner Klasse"; der Autor, geboren 1985 in Kaiserslautern, erzählt darin seine Kindheit in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts, eine Kindheit, die durch Armut, Alkoholismus, Gewalt, Hunger, Unterdrückung und Machtmissbrauch eine "Sozialgeschichte von unten" aufblättert. Die Literaturkritik horchte auf, denn hier beschreibt einer authentisch das erbärmliche Arbeiterleben in der Provinz. Nun setzt Baron seine Autobiographie als Roman fort, verarbeitet werden darin die Lebensgeschichten seiner Familie, aber "alle Figuren sind frei erfunden".
Der Autor schreitet zeitlich nicht voran, sondern geht eine Generation zurück: "Ich wollte wissen, warum mein Vater so geworden ist, wie er geworden ist." Diese Generation, um das Jahr 1930 geboren, will er nicht verklären und nicht verdammen, er will sie verstehen lernen. Was sind ihre Lebenserfahrungen zu einer Zeit, als Baron noch gar nicht geboren war?
Der Roman setzt ein mit einem Epilog im Januar 1944. Zwei Jungen, der eine zehn Jahre alt, der andere noch keine sechzehn, treffen sich im zerbombten Kaiserslautern und kommen ins Gespräch. Der Ältere, als HJ-Junge, will den Jüngeren zurechtweisen und bedroht ihn zunächst, dann erfährt er, dass der Kleine im Waisenhaus lebt, seine Mutter, eine Prostituierte, verloren hat und sein Vater als "Asozialer" im KZ Dachau sitzt. Der Ältere erzählt, seine Eltern seien beide Kommunisten, der Vater wurde in ein Strafbataillon abkommandiert, die Mutter steckte den Sohn in ein Heim, um ungestört ihrer bolschewistischen Arbeit nachgehen zu können. Der Ältere will helfen und den Kleinen verstecken, Ob das nicht zu gefährlich sei, fragt der Kleine, der Große antwortet: "Wir sind anständige Deutsche. So kurz vor dem Endsieg würden die in deinem Waisenhaus das nicht begreifen. Aber danach werden sie mir einen Orden verleihen für die Rettung eines arischen Jungen, da kannst du dich drauf verlassen."
Aufschwung in einer Kneipe namens "Goldmine"
Sie stellen sich vor: Der Kleine heißt Horst Baron, der Große Willy Wagner. Es sind die Großväter väterlicher- und mütterlicherseits des Autors. Und nun macht der Roman einen weiten Sprung in die Siebzigerjahre, die beiden treffen sich im bundesdeutschen Wirtschaftswunderland in Kaiserslautern wieder, 1973, 1976, 1979. Beide wollen ihr Glück machen, teilhaben am Aufschwung, nur sind ihre Charaktere sehr verschieden, Willy möchte ein "anständiger" Mensch sein, "ich will eine sichere Anstellung mit Funktion im Betrieb und mit Frau und Kindern einen guten Lebensstandard haben". In der Kneipe "Goldmine" sitzt Horst: "Alle sprachen sie immer von anständiger Arbeit, doch schon die Idee fand er im Grunde zum Kotzen. Wieso waren sie alle so erpicht darauf, sich gegen ein bisschen Schmerzensgeld kaputtzuschuften? Wie aufs Stichwort stapfte Willy herein in die Spelunke. Der strebsamste aller Männer. Was haben all die Jahre harter Arbeit den Kerl abgewrackt, dachte Horst. Und darauf bildet der sich noch was ein. Horst nickte ihm zu. Willy schüttete sein Pils in sich hinein."
Die Freundschaft ist brüchig, denn keiner von beiden reüssiert, weder wirtschaftlich noch persönlich. Der strebsame Willy braucht lange, bis er endlich eine feste Stellung als Polier findet, und als er die hat, stürzt er vom Dachfirst und ist Invalide; Horst dreht unaufhörlich krumme Touren, in die er auch Willy mit hineinzieht, er landet im Gefängnis und hintergeht Willy, wo er nur kann. Die familiären Verhältnisse sind desaströs. Die Kinder verlassen im Streit die ärmlichen Wohnverhältnisse. Die Ehefrauen beziehungsweise Lebensgefährtinnen werfen sich vor den Zug oder sterben an Krebs, eine Tochter wird mit sechzehn Jahren schwanger und stirbt ebenfalls an Krebs, ein Sohn erliegt dem Suff. Nichts will gelingen. Schlägereien, brutale Wortgefechte, häusliche Kampfszenen sind an der Tagesordnung. Das kapitalistische System muss funktionieren und wird mit aller Härte durchgesetzt. Wer nicht pariert, wird vor die Tür gesetzt. Mitleid gibt es in dieser rauen Welt nicht.
Vehemente Verteidigung des Arbeitermilieus
Wie Hohn klingt der Titel "Schön ist die Nacht" - das ist ein Tango, zu dem Willy und seine Frau Rosi sich verliebt haben, als sie zum ersten Mal miteinander tanzten. Als Rosi auf dem Totenbett liegt, legt Willy zum letzten Mal ihren Lieblings-Tango auf, dann schreit er seine Wut auf das Leben aus dem Fenster. Keiner findet einen Ausweg; so war es auch schon im ersten Teil der Lauterer Chronik. Prekariat bleibt Prekariat. Alle sind gefangen in einem Ghetto der Aussichtslosigkeit. Nur eine weiß Rat: Hulda, die immer noch bekennende Bolschewikin und Mutter von Willy. Alle suchen Trost bei ihr, aber niemand folgt ihren Worten. Willy fragt sie voller Ingrimm: "'Warum liest du die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Du wohnst doch gar nicht in Frankfurt.' 'Sehr witzig', sagte Hulda. 'Man muss den Feind kennen, damit man ihn besiegen kann', deklamierte sie aus ihrem Bestand an Parteitagsgesprächen."
Die Hauptpersonen sprechen ein schlichtes Hochdeutsch, Nebenfiguren (wie Luis der Stinker oder S-Bahn-Dirk) ergehen sich in breitem Pfälzisch. Das schafft eine dichte Atmosphäre. Hier schmeckt nicht einer in eine fremde Welt hinein, hier wird gelebtes Leben erzählt mit all dessen Kanten, Ecken, Ungereimtheiten und Gemeinheiten. Der Autor heischt nicht nach Mitleid beim Publikum, er verteidigt vehement eine Welt im Arbeitermilieu, die abseits der Metropolenliteratur literarisch und poetisch zu Gehör gebracht werden muss. Warten wir also voller Neugier auf den dritten Teil dieser Lauterer Trilogie, an der Baron - beflügelt vom großen bisherigen Erfolg - bereits schreibt. LERKE VON SAALFELD
Christian Baron: "Schön ist die Nacht". Roman.
Claassen Verlag, Berlin 2022. 378 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ein fulminanter Roman [...]. Baron lässt uns emotional nie kalt, weil er nicht distanziert von fern erzählt, wie etwa Didier Eribon oder Annie Ernaux...Er steckt voller Schmerz und Zorn, Angst und Hoffnung, Liebe und Hass, das macht das Buch kraftvoll und vor allem sprachlich authentisch. [...] Dieser Roman mutet Wechselbäder der Gefühle zu, und genau das macht ihn lesenswert.« Elke Heidenreich Süddeutsche Zeitung 20220726