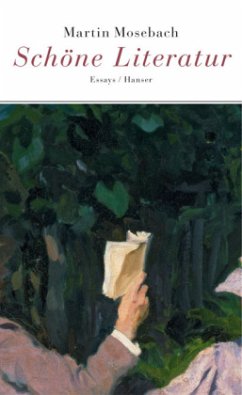Martin Mosebach ist seit langem einer der bedeutendsten Essayisten und Kritiker in der deutschsprachigen Literatur. Sprachlich virtuos und mit einer umfassenden, beeindruckenden Kennerschaft verfolgt er Literatur und Kunst, aber auch Politik und Religion - in Aufsätzen, die immer unzeitgemäß sind, überraschend und gegen den Strom. Eine große Verteidigung des Romans, der Kunst und des Denkens gegen alle Moden des Zeitgeistes.

Der Büchnerpreisträger Martin Mosebach in seinen Essays
Derzeit dürfte Martin Mosebach an seinem Schreibtisch sitzen, grübelnd, was ihm Georg Büchner zu sagen hat. Nicht ganz freiwillig: Es gehört zu den Pflichten des Büchnerpreisträgers, sich auf den Namenspatron einzulassen. Mosebach und den revolutionären Feuerkopf der Menschenrechte scheint indes nicht viel zu verbinden. Das Problem ist nicht neu. Mit Golo Mann etwa erhielt ein anderer Konservativer den Büchner-Preis, ausgerechnet im studentenunruhigen Jahr 1968. Seine Rede über "Georg Büchner und die Revolution" wurde von Tumulten begleitet.
Golo Mann war es, der den Schriftsteller Martin Mosebach entdeckte und ihm 1980 den Förderpreis der Ponto-Stiftung zuerkannte - nicht ohne dem jungen Mann ins Gewissen zu reden, er hoffe doch, dieser werde seinen erlernten Beruf, die Juristerei, nicht für das unsichere Los der freien Schriftstellerei aufgeben. Manchmal ist es erfreulich, wenn ein wohlgemeinter Rat ausgeschlagen wird.
Mosebach wird die Herausforderung Büchner meistern. Vielleicht mit einer überraschenden Wendung, etwa indem er uns Büchner als Reaktionär präsentiert. Das wäre aus seiner Feder ein hohes Lob, mit dem er nur seine großen Vorbilder, den kolumbianischen Aphoristiker Nicolás Gómez Dávila und vor allem Heimito von Doderer, auszeichnet. Wobei "Reaktionär" bei Mosebach nicht jemanden meint, der das Rad der Geschichte zurückdrehen will, sondern einen, der bewahrt, was wert ist, bewahrt zu werden.
Mosebach hat es nicht nötig, mit den Manschettenknöpfen der Originalität zu klimpern - und überrascht doch. Etwa im Essay "Dichter ohne Heimat", in dem es, ungewöhnlich, nicht um den Exodus der NS-Zeit geht. Hier liest man von "innerer Emigration" und bekommt nicht erneut den fürchterlichen Frank Thieß serviert, sondern: Goethe. Der habe den zweiten Teil seines "Faust" in die Schublade gelegt, weil er sich am Ende seines Lebens vorgekommen sei, als sitze er auf einer einsamen Insel. "Beinahe unheimlich ist der Anblick solcher Schöpferkraft, die ungetröstet nur aus sich und für sich selbst zu bestehen vermag, nachdem die möglichen Leser, gewogen und zu leicht befunden, wie Spreu weggeblasen worden sind."
Mosebach zeichnet etwas aus, das bei Schriftstellern aus der Mode gekommen ist: die Fähigkeit zu Bewunderung und Anlehnung. Er würdigt in seinen Essays, die oft zuerst in dieser Zeitung erschienen, die großen Kollegen von Kleist bis Kempowski und scheut auch den Superlativ nicht. Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" ist ihm etwa "das bedeutendste Romanwerk des zwanzigsten Jahrhunderts". Nicht müde wird er, immer wieder zu betonen, Doderer sei der "wahrscheinlich bedeutendste Autor deutscher Sprache im zwanzigsten Jahrhundert".
Das ist nicht nur eine Frage der Sympathie. Mosebach entwirft in seinen Essays eine Typologie der von ihm geschätzten Literatur. Sie entspringt der südlichen Welt (im Deutschen der süddeutsch-österreichischen), und Mosebach nennt sie, wie einen seiner Essays, "katholische Literatur", wobei es ihm nicht um ein Dogma geht, sondern um Ästhetik und ein Erleben der Welt und ihre literarische, auch humorvolle Reflexion. Aus dieser Perspektive wird aus dem Agnostiker Proust kein gläubiger Katholik, aber ein Autor katholischer Literatur. Die Gegenwelt wird auch entworfen: die protestantisch-akademische mit ihrem letzten König Thomas Mann. Deren Sprache und Literatur, die auf der Reformation beruht, die das Latein aus der Theologie und der Liturgie verdrängte (man denke auch an Mosebachs Eintreten für die Rückkehr zur lateinische Messe) und die das "Kunstprodukt" Hochdeutsch etablierte, steht Mosebach nicht nahe - so glanzvoll es in diesem "akademischen Käfig" auch zugehen könne.
Viel Ernst, aber auch Lust an der Provokation wohnt in solchen Aussagen. Mosebach sucht als Essayist das Gespräch, nicht die Kanzel. Er ist eben auch, trotz eleganten Auftritts, ein Bürger auf Abwegen, ein Freund der Ordnung, der aber Interesse nur für das hegt, was von ihr abweicht und in dessen Romanen nicht zufällig lauter verkrachte Existenzen hausen. Entsprechend ist auch die Vehemenz zu verstehen, mit der er Heimito von Doderer, den großen Bogenschützen, der in das Herz einer breiten Leserschaft nie traf, in den Vordergrund rückt - Mosebach würde wohl nicht derart insistieren, wenn diesem nur endlich die Ehre widerführe, die ihm so lange schon versagt ist. Bis dahin erklingt der Ruf: "Heimito der Große": "Man warte noch ein paar Jahrzehnte, dann werden's alle wissen." Dass Martin Mosebach einer der besten deutschen Essayisten der Gegenwart ist, wissen wir schon heute.
TILMANN LAHME
Martin Mosebach: "Schöne Literatur." Essays. Hanser Verlag, München 2006. 236 S., geb., 19,90 [Euro].
Martin Mosebach: "Die Kunst des Bogenschießens und der Roman". Zu den "Commentarii" des Heimito von Doderer. Themenband Nr. 85 der Carl Friedrich von Siemens Stiftung, München 2006. 67 S., br., Abb. Der Band ist auf Anfrage kostenlos bei der Siemens Stiftung erhältlich.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Eine große Bewunderung spricht aus Martin Zinggs Besprechung dieses Essaybandes. Gewissermaßen leitmotivisch wird auf die "unaufdringliche" Noblesse von Martin Mosebachs Stil verwiesen, der umfassendes Wissen und weit reichende intellektuelle Neugier spielerisch zu verbergen versteht. Ein weiteres Kunststück Mosebachs sei der Überraschungseffekt, einerseits durch seinen erstaunlich "aktuellen" Blick auf die vermeintlich jenseitigen Klassiker, andererseits durch kühne Vergleiche beispielsweise zwischen Rüpeleien in Kleists "Penthesilea" und Shakespeares "Sommernachtstraum". Und wenn dann noch die unzeitgemäße Frage als Titel auftaucht: "Was ist katholische Literatur", dann sei man als Leser vollends irritiert und zugleich beglückt. Denn Martin Mosebach, so der Rezensent, gehe es auch hier um Dinge, die man nie erraten hätte, und die er mitnichten einfach so beantworte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH