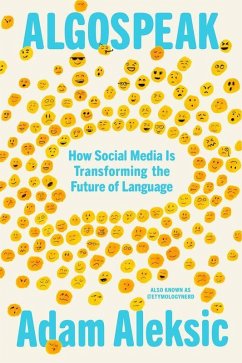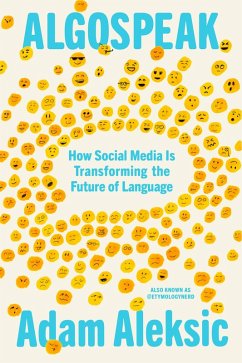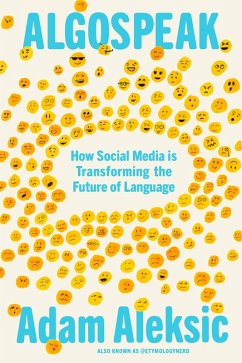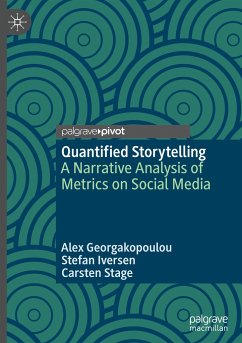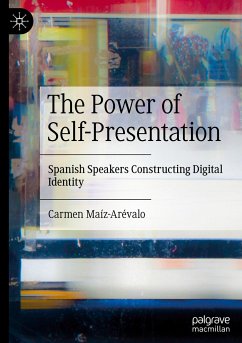Schreiben digital
Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Längst macht das Schreiben im Internet einen Großteil unserer Alltagskommunikation aus. Wir pflegen damit unsere Kontakte, organisieren unsere Termine, wir informieren Freunde darüber, wo wir gerade sind und was wir genau tun, oder wir vertreiben uns schlicht die Zeit, wenn wir auf den Bus warten oder im Zug sitzen. All das ist nur möglich, weil die meisten von uns mit einem kleinen Gerät ausgestattet und so praktisch immer und überall 'online' sind.Kann die Kommunikation außerhalb des Internets davon völlig unbeeinflusst bleiben? Die Antwort lautet sicherlich: nein. Wie genau das Schr...
Längst macht das Schreiben im Internet einen Großteil unserer Alltagskommunikation aus. Wir pflegen damit unsere Kontakte, organisieren unsere Termine, wir informieren Freunde darüber, wo wir gerade sind und was wir genau tun, oder wir vertreiben uns schlicht die Zeit, wenn wir auf den Bus warten oder im Zug sitzen. All das ist nur möglich, weil die meisten von uns mit einem kleinen Gerät ausgestattet und so praktisch immer und überall 'online' sind.Kann die Kommunikation außerhalb des Internets davon völlig unbeeinflusst bleiben? Die Antwort lautet sicherlich: nein. Wie genau das Schreiben im Internet unsere Alltagskommunikation verändert hat und weiter verändert, möchte dieser Essay klären - und zwar aus erster Hand: Christa Dürscheid und Karina Frick beschäftigen sich schon seit Jahren professionell mit dem Thema SMS- und Internetkommunikation; in ihrem durchaus unterhaltsamen Essay stellen sie ihre Erkenntnisse einem breiten Publikum zur Verfügung.