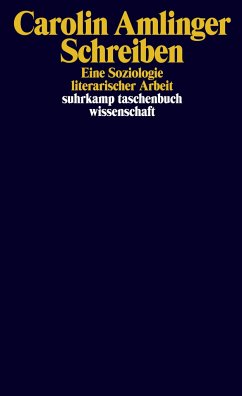Das Ende der Buchkultur ist nicht zu befürchten - wie Bücher gemacht werden, wandelt sich indessen. Mit dem Augenmerk auf die jüngere Geschichte des Buchmarktes leistet Carolin Amlinger eine umfassende Bestandsaufnahme ästhetischer Ökonomien, die auch einen Blick in die Zukunft des Buchgeschäfts erlaubt. Gleichzeitig verdichtet die Studie die vielfältigen Arbeits- und Lebenswelten von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren zu einer fesselnden soziologischen Analyse, die nahezu alle Facetten der Arbeit mit dem geschriebenen Wort beleuchtet. Ein Buch, das uns die Welt des Büchermachens erschließt.

Berufung, nicht Beruf: Carolin Amlinger leistet soziologische Aufklärung in Form einer dichten Beschreibung des Literaturbetriebs.
Von Niels Werber
Auf den Visitenkarten von Romanciers finden sich Bezeichnungen wie "Ernst Jünger cand. zool., Ltn. a. D." oder "Dr. phil. Robert Musil". Die Angabe "Berufsschriftsteller" oder heute "Diplom-Schriftsteller:in" scheint unüblich zu sein, obschon Studiengänge entsprechende Zertifikate verleihen. Auch die "18 Autor:innen aus Deutschland zwischen 32 und 62 Jahren", mit denen Carolin Amlinger Interviews geführt hat, um zu verstehen, wie sie arbeiten und "welchen Sinn sie ihrer Arbeit zuschreiben", erleben ihre Tätigkeit weniger als einen "durch zweckrationale Kalküle bestimmten Beruf", mit dem Geld verdient würde, "sondern als innere Berufung", der sie "um ihrer selbst willen" folgen. Ein Diplom macht niemanden zum Autor. Ein festes Einkommen auch nicht.
Warum eigentlich nicht? Ist denn das literarische Werk etwa keine Ware, die in Heimarbeit hergestellt und als Halbfabrikat an einen Verlag verkauft wird, der es druckt, vertreibt und bewirbt? Es gehört zum Kernbestand der Erwartungen, die unsere Gesellschaft ihren Mitgliedern ermöglicht, aus einem Angebot von Waren wählen zu können, zu dem auch Bücher gehören. Aber Literatur will mehr als eine Ware sein, nämlich Kunst, die um ihrer selbst willen geschaffen und um ihrer selbst willen rezipiert wird. Diese soziale Disposition des literarischen Feldes, die Amlinger beschreibt, ist alt, aber wirkungsmächtig. Personen, die "Heftromane" oder "Genreliteratur" gegen festes Entgelt nach "Produktionsrichtlinien" fabrizieren, gelten nicht als Schöpfer eines Werks, obschon sie Texte schreiben, die gedruckt und gelesen werden, und dies sogar in großer Zahl. Dass Autoren diese Brotarbeit unter Pseudonym verrichten, um ihren guten Namen zu schützen, legt ein Problem moderner Autorschaft offen, das Amlinger in ihrer Feldforschung herausarbeitet: Das Schreiben literarischer Texte prekarisiert.
Die Ansprüche, die die Schriftsteller an sich selber stellen, stehen einer Professionalisierung ihres Berufs genauso im Weg wie die Überzeugung des "Literaturbetriebs", die Produktion von Werken sei das im Einzelfall zufällige, insgesamt aber doch erwartbare Ergebnis individueller Kreativitätsschübe. Auf die Idee, Autoren fest einzustellen, zu versichern, im Krankheitsfall und Urlaub ein Gehalt zu zahlen, ist noch kein Literaturverlag gekommen, jene "Fabriken" ausgenommen, in denen "Massenware" produziert wird.
Die Urheber, die so glücklich sind, in ihrer vollkommenen Freiheit von allen Zwängen moderner Berufsausübung ein Werk vollendet und an einen Verlag verkauft zu haben, dürfen sich stattdessen über ein "Honorar" freuen, eine Ehrengabe also, die der Wertschätzung für ihre Berufung geschuldet ist und nicht der Arbeit, die die Autoren in ihr Schreiben investiert haben. Wer will schon von Stundenlöhnen sprechen, wenn ein Werk entsteht? Die Illusionen von Zweckfreiheit und Autonomie haben die Produktionsbedingungen so erfolgreich invisibilisiert, dass die interviewten Autoren viel auf sich nehmen und ihrem Umfeld viel zumuten, um im Schreiben das zu tun, was sie als Mensch ganz und gar definiert, und das heißt: trotz allem ihr nächstes Werk zu schaffen. Kein Wunder, dass sich die meisten Schriftsteller wie vor hundert Jahren von Job zu Job, von Honorar zu Honorar, von Preis zu Preis hangeln, wenn sie ihr Tun als existenziellen Vorgang fassen, in dessen "Vollzugsgeschehen" sie zugleich aufgehen und sich selbst erst hervorbringen. "Ich muss schreiben", gibt eine Autorin zu Protokoll, sie hätte auch "ich muss leben" sagen können.
Wie die Konzeption des Buches als Ware und Werk ist auch die Konzeption des Schriftstellers voller "metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken" (Karl Marx). Das "Gebrauchswertversprechen", das dem Käufer suggeriert, er erwerbe ein "ästhetisches Werk mit besonderen Qualitäten", wird von der Fiktion des begabten, berufenen oder doch besonderen Autors gedeckt, der dieses Werk nicht als Ware für den Markt hergestellt habe, sondern gerade im selbstbezüglichen, quälenden wie befreienden Schreiben ein "Kulturgut" schafft, ja schaffen musste, das genauso einzigartig ist wie der Prozess, aus dem es hervorgeht. Aus Sicht der Soziologin lässt sich dies nüchtern als "Distinktionsstrategie" fassen, an deren Erfolg die Verlage und Agenten, Kritiker und Literaturwissenschaftler kräftig mitwirken, um die Antinomien dieser ästhetischen Ökonomie zu bewirtschaften.
Zur soziologischen Aufklärung, die Amlinger betreibt, gehört es, das Milieu und die Medien, die Organisationen und Rechtsformen in den Blick zu nehmen, ohne die weder dieses Verständnis von Autorschaft noch diese Konzeption des Werkes denkbar wären. Ihre Soziologie des Schreibens nimmt all die Praktiken ins Visier, die mit diesen Möglichkeitsbedingungen zurechtkommen müssen, um die Regale mit 'wertvollen Werken' zu füllen, deren Ladenpreis nichts bedeuten darf für ihren kulturellen Rang und deren Urheber statt auf festes Gehalt auf Reputationsgewinne setzen, vom Stipendium zum Buchpreis, von der großartigen Rezension bis zur gefeierten Lesereise.
Zwar ist der Markterfolg einiger Bestsellerautoren so überwältigend, dass der Hinweis auf die schiere Zahl der Rezipienten jede Diskussion über den ästhetischen Wert des Werks erstickt, aber solange die Unterscheidung von Beruf und Berufung so fest etabliert ist, wie die dichten Beschreibungen der Interviews und Hintergrundgespräche mit wichtigen Akteuren des Literaturbetriebs zeigen, wird sich daran nichts ändern. Schreiben wird weiter beglücken und frustrieren, und zwar die Schreibenden wie die Lesenden, unabhängig vom später erzielten Honorar und losgelöst vom für den Erwerb des Buches bezahlten Preis.
1934 hat Walter Benjamin die Sonderbarkeit von "Produzenten" beschrieben, die irrigerweise darauf bestehen, keine Ware anzufertigen, sondern eine Schöpfung hervorzubringen, keine Zwecke zu verfolgen, sondern die "Autonomie des Dichters" auszuleben, zu "dichten, was er eben wolle". Dies sei falsch, es gelte, die "isolierten Dinge: Werk, Roman, Buch" in "die lebendigen gesellschaftlichen Zusammenhänge" zu stellen. Dieser Devise ist Amlinger gefolgt: "Literarisches Arbeiten wird hier als eine soziale Tätigkeit interpretiert, die sich nicht losgelöst von den gesellschaftlichen Beziehungen und Strukturen, in die sie eingebettet ist, erschließen lässt." Was Schreiben, dieses Arbeiten ohne Arbeitszeiten, diese Produktion, die ihre Produktionsbedingungen verleugnet, indem sie ihre Produkte als Schöpfungen sakralisiert, heute ausmacht, lässt sich bei ihr nachlesen. Und dies wird nicht nur aus der Sicht der einen oder anderen soziologischen Theorie deduziert und an ein paar Beispielen illustriert, sondern aus der Feldforschung kondensiert. Dies ist keine armchair sociology, deren Realitätskontakt in Zeitungslektüren aufgeht, sondern qualitative Soziologie. Wenn Bücher als Visitenkarten ihrer Autoren fungieren, dann darf die Dissertationsschrift der Literatursoziologin Carolin Amlinger als Empfehlung gelten.
Carolin Amlinger: "Schreiben". Eine Soziologie literarischer Arbeit.
Suhrkamp Verlag Berlin 2021. 800 S., br., 32,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensent Jörg Plath zeigt sich beeindruckt von der "Fülle der Befunde" und der klugen Methodik, mit der Carolin Amlinger sie gewinnt und der leicht verständlichen Art, mit der diese Befunde präsentiert werden. Amlingers umfangreiche soziologische Studie, so Plath, besteht aus drei Teilen, in denen verschiedene Dimensionen des Schreibens beleuchtet werden. Dabei arbeitet sie präzise und anschaulich das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum in Bezug auf die Schreibpraxis heraus, welches sich vor allem im Widerspruch zeigt zwischen der Vorstellung von der Autonomie künstlerischen Schaffens auf der einen und der Warenform des Buches auf der anderen Seite, so Plath. Dass Amlinger andere als kulturelle Einflussfaktoren eher vernachlässigt, kann der Rezensent ihr leicht verzeihen angesichts der 800 Seiten, die Amlinger schon ohnedies zu füllen weiß.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[Das Interview-Vorgehen] macht Amlingers Schreiben zu einem ... gut lesbaren Buch. ... Dabei beeindruckt die Umfasstheit von Amlingers Schreiben ...« Gerrit Bartels Der Tagesspiegel 20211221