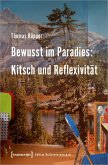Warum schreit man? Aufgrund von Schmerz, Verzweiflung, Lust, Machtbegehren und Wahnsinn? In 15 Essays wird die archaische Unartikuliertheit in Situationen des Außer-sich-Seins typologisch entfaltet. Nicht nur variieren Schreianlässe und Funktionen in erheblichem Maße, auch die medialen Darstellungen, die Rezeptionsformen sowie die moralischen und ästhetischen Bewertungen sind außerordentlich vielfältig. Auf der Grundlage von literarischen, philosophischen, psychiatrischen, mythologischen und kunsttheoretischen Texten, von Bildern (Fotografie, Malerei, Druckgrafik, Zeichnung) und Filmen werden das Schreien, das Brüllen, Kreischen und Heulen als Grenzphänomene erkennbar. Gegensätze wie Humanität und Animalität, Kommunikationswunsch und -abbruch, Ich-Behauptung und -Verlust lösen sich im Schrei auf.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Zwar navigiert Gunnar Schmidt souverän durch zahlreiche "historisch-thematische Denkbilder" der Kulturgeschichte des Schreis von der Antike bis zur Gegenwart. Trotzdem fühlt sich Rezensent Berd Stiegler gelegentlich ein wenig durchgeschüttelt und ist immer wieder dankbar, wenn sich das Buch wieder "auf seine Grundeinsichten besinnt". Dabei hat Schmidts Studie über den Schrei "durchaus System", versichert der Rezensent, der das Buch insgesamt empfehlen kann. Denn Schmidt erwähne viele Aspekte nur am Rande - gerade darin liege der historiografische Kniff des Buches, den Leser durch wechselnde Verknappung und Verdichtung immer wieder auf die Spur des Wesentlichen zu bringen. Das ist für Stiegler die Erkenntnis, dass der Schrei eine "Form der Regression" ist, die zum Elementaren führt und zugleich herkömmliche kulturelle Formate sprengt. Der Schrei erscheint hier auch als "Ausdrucksgestalt einer Kulturverlassenheit", die den Kritiker beunruhigt zurücklässt, aber mit dem Gefühl, eine "erhellende" Kulturanalyse gelesen zu haben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH