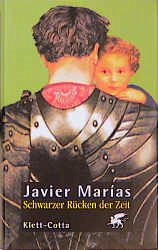Wird eine Geschichte in der ersten Person Singular erzählt, werden ferner Dinge erwähnt, die dem Autor selbst tatsächlich zugestoßen sind, dann mag es verführerisch sein, den Autor gleichzusetzen mit dem Ich-Erzähler. Das geschah Javier Marías mit einem Roman. Er erhielt Anrufe von Freunden und völlig Fremden, die sich in gewissen Figuren wiedererkannt hatten; und er hörte von anderen, die sichtlich verschnupft waren, weil sie nicht vorkamen. Die Wahrheit war: alle Romanfiguren waren erfunden, die einzig nicht-erfundene Figur war ein wenig bekannter Schriftsteller, der lange tot war. Ein Beweis für die Macht der Fiktion, Wirklichkeit zu schaffen ohne ein reales Vorbild; und Vergessenem durch Erzählen Dauer zu verleihen.
Um diese Gedanken kreist dieser neue Roman von Javier Marías. Plaudernd, ironisch, klug, immer unterhaltsam verfolgt Marías wie ein Detektiv die abenteuerlichen Lebensläufe des Dichters Gawsworth, dessen Mentors Wilfried Ewart oder des Abenteurers Hugh Oloff de Wet, deren Wege sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder gekreuzt haben. Lücken in ihren Biographien füllt er gekonnt mit Erfundenem. Die Übergänge zwischen der Rekonstruk-tion eines Ereignisses und der erzählerischen Imagination sind fließend und legen nahe, daß es sich bei "Schwarzer Rücken der Zeit" selbst möglicherweise um eine subtile Fälschung handeln könnte.
Um diese Gedanken kreist dieser neue Roman von Javier Marías. Plaudernd, ironisch, klug, immer unterhaltsam verfolgt Marías wie ein Detektiv die abenteuerlichen Lebensläufe des Dichters Gawsworth, dessen Mentors Wilfried Ewart oder des Abenteurers Hugh Oloff de Wet, deren Wege sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder gekreuzt haben. Lücken in ihren Biographien füllt er gekonnt mit Erfundenem. Die Übergänge zwischen der Rekonstruk-tion eines Ereignisses und der erzählerischen Imagination sind fließend und legen nahe, daß es sich bei "Schwarzer Rücken der Zeit" selbst möglicherweise um eine subtile Fälschung handeln könnte.

Mir zur Feier: Javier Marías weiht sich ein Denkmal
Die schlechte Nachricht zuerst: Javier Marías ist unter die Sprachphilosophen gegangen. Zu Beginn seines neuen Buches und am Ende und zwischendurch bei jeder Gelegenheit geht es seitenweise und, wie sich bald herausstellt, in halsbrecherischen Gedankensprüngen um das "Wort", das "in sich selbst metaphorisch" sei, und den "Begriff", für den irgendwie dasselbe gelte, um den Tod des Autors, um Tatsachen und Sprache. Es gebe keine Wirklichkeit, erfährt man; aber die Fiktion verfälsche sie. Auch "die Tatsachen an sich sind nichts, die Sprache kann sie nicht reproduzieren". Wer sich da fragt, warum man denn überhaupt auf die Idee kommen sollte, ein Nichts zu reproduzieren, sollte die Lektüre umgehend wieder einstellen. Denn die hochtrabende Platitüde ist die Grundfigur dieses Buches und der verstolperte Anlauf seine bevorzugte Bewegungsform. "Ich bin", läßt er uns wissen, "nicht der erste Schriftsteller und werde auch nicht der letzte sein, dessen Leben durch das bereichert oder verdammt oder nur verändert wird, was er erdacht oder erdichtet und geschrieben und veröffentlicht hat." Falls also ein Leser bisher angenommen haben sollte, das Schreiben und Veröffentlichen bliebe für einen Schriftsteller normalerweise folgenlos - hier wird er eines Besseren belehrt. Aber kann man die offenen Türen mit größerem Aufwand einrennen als mit diesem Gefuchtel von "erdacht und erschrieben" und "verdammt"?
Das aus alldem begründete Vorhaben dieses Buches, das zwischen Essay und Erzählung oszillieren soll, erweist sich als wunderlich genug. Um nichts anderes soll es gehen als um die Vor- und Nachgeschichte eines uns wohlbekannten Buches, des 1997 in deutscher Übersetzung erschienenen Marías-Romans "Alle Seelen". Von dieser liebevoll satirischen Universitäts-, Bibliophilen- und Liebesgeschichte, von den dort gefundenen oder erfundenen Menschen und Büchern, von den Reaktionen in Oxford und der Welt: von alldem soll hier erzählt werden - und zwar vorsätzlich "ohne Motiv und fast ohne Ordnung und ohne vorherigen Entwurf und ohne Suche nach Kohärenz", also "völlig zufällig und willkürlich, rein episodisch und akkumulativ". Wie man sieht, ist das erste Prinzip dieses Vorsichhinredens die Wiederholung.
Nicht mit theoretisch anfechtbarer Autor-Stimme will der Erzähler dabei reden, sondern "mit einer launischen, unvorhersehbaren Stimme, die wir jedoch alle kennen, der Stimme der Zeit, wenn sie noch nicht vergangen und auch nicht verloren ist und vielleicht eben deshalb nicht einmal Zeit ist". Wie immer man sich aber die so umständlich beschriebene Stimme vorstellen mag - zu Wort kommt, wie sich rasch herausstellt, dann doch bloß Javier Marías selbst - und in ganz eigener Sache. Auch das Versprechen besinnungslosen Drauflosschreibens wird bald gebrochen. Denn natürlich ordnen sich die scheinbar planlos ausgestreuten Bilder und Anekdoten rasch zu Erzählsträngen, bilden die wiederholten, gebrochenen und gespiegelten Motive und Zitate Beziehungsnetze, fügen sich die akkumulierten Episoden zum Buch.
In dessen Zentrum aber steht weder der Oxforder Roman noch das leitmotivisch in Erinnerung gebrachte Vexierspiel von Literatur und Leben, sondern der Literat persönlich. Marías erzählt hier, mit Rilke zu reden, "mir zur Feier". Nichts hält das vorgeblich frei flottierende Schreiben so straff zusammen wie das Lob seines Autors, der sich nicht sattsehen kann an seinem Werk. Keineswegs, läßt er uns wissen, sei der Schreiber jenes Romans mit dessen Helden identisch gewesen. Durchaus nicht alle der übrigen Figuren hätten ein reales Vorbild, auch wenn ihre eindringliche Darstellung zu manchen nachträglichen Identifikationen geführt habe. Umgekehrt sei manches vermeintlich Erfundene der Wirklichkeit wörtlich abgeschrieben; und so fort.
Derlei Mitteilungen sind nach anderthalb Jahrhunderten realistischer Gesellschaftsromane nicht nur ziemlich überraschungsfrei. Nebenbei und unfreiwillig unterstellen sie auch eine Wirklichkeit, die der theoretische Vorspann gerade bestritten hatte. Nicht, daß Marías sich nicht gelegentlich wieder daran erinnerte; dann beherzigt er die Maxime vom Tod des Autors und versichert: "Ich selbst begrabe mich mit dem, was ich hier schreibe." Aber das Begräbnis sieht doch eher nach einer Denkmalseinweihung aus.
Ausdauernd und hingerissen zitiert der Erzähler aus seinen Romanen und Erzählungen, aus Artikeln und Gesprächen, nie ohne Hinweise auf die jeweiligen Fundstellen. Selbstverliebt kichernd wiederholt er ganze Passagen aus dem, was er selbst "meine . . . aberwitzige Sicht der Stadt und der Universität Oxford" nennt. Wörtlich erinnert er sich an jedes Lob Dritter ("Dein bisher bester Roman"; "Exquisit"), und nicht genugtun kann er sich mit Beispielen für den Ehrgeiz seiner britischen Leser, sich in seinem Roman wiederzufinden oder, wenn das nicht gelingt, doch wenigstens in seinem nächsten vorzukommen. Vorgeblich soll das alles zeigen, wie ein Oxford-Roman das reale Oxford zu verändern vermag, wie Fiktion und Wirklichkeit einander durchdringen, wie die Zeitlichkeit der sterblichen Menschen aufgehoben wird in der Zeitlosigkeit der Kunst - große Themen nicht nur dieses bedeutenden Schriftstellers.
Und tatsächlich beherrscht Marías auch hier sein erzählerisches Handwerk auf weiten Strecken mit gewohnter Bravour. Humoristische Miniaturen und schillernde Mystifikationen führen auch hier manchmal hübsche Seiltänze auf. Aber eigenartig - was in früheren Büchern zur Zauberei wurde, langt hier bestenfalls zum Kunststück. Der Effekt des übertriebenen Understatement ist Imponiergehabe. Je lauter der Autor seinen Tod beteuert, desto vitaler tritt er hervor; je aufwendiger er seine Ohnmacht gegenüber der Eigenmächtigkeit des Erzählens hervorkehrt, desto selbstherrlicher wird sein Ton. Tricks und Taschenspielereien, deren Lässigkeit seine Leser früher entzücken konnten, wirken auf einmal aufdringlich; denn nicht dem Spiel gilt seine Aufmerksamkeit, sondern der mit sichtlicher Anstrengung vorgeführten Lässigkeit. Und selbst die Virtuosennummer wird verdorben durch stilistische Ausrutscher, durch das mechanische Pathos eines wiederholten "Othello"-Zitats oder flache Scherze wie die Mitteilung, er habe einen "roman à clef" geschrieben - "Sie wissen schon: französisch für ,Schlüsselroman'." (Auch sollte ein Erzähler, der es Borges nachtun will, nicht selbst zuvor augenzwinkernd das Stichwort "borgesianisch" fallenlassen.)
Das aber ist das Ärgerlichste an diesem ärgerlichen Buch: daß Marías seine eigene Erzählkunst durch Mißbrauch diskreditiert. Wie ein Schauspieler, dem im Interview über eine frühere Rolle jede Antwort zum großen Monolog gerät, verrät er seine Kunst, indem er sie am falschen Platz ausübt und übertreibt. Das Ergebnis dieser Vermischungen ist hybrid, in des Wortes doppelter Bedeutung. Was als Essay allenfalls amüsant sein könnte, wird im Großformat zur peinlichen Spiegelfechterei. Dabei wird selbst "dieser Band nicht ausreichen und vielleicht auch nicht der geplante zweite". Wenn es aber etwas gibt, das die Lektüre dieses Buches an Ödnis noch übertrifft, so ist es die Vorstellung eines zweiten Bandes. Ebendarum bleibt unter seinen vielen redundanten Sätzen mindestens einer beherzigenswert: "Entweder hört man mir zu oder man tut es nicht, man braucht es nicht zu tun." Das ist, zum Schluß, die gute Nachricht.
HEINRICH DETERING
Javier Marías: "Schwarzer Rücken der Zeit". Aus dem Spanischen übersetzt von Elke Wehr. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2000. 377 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
In einer recht inhaltsreichen Rezension geht Albrecht Buschmann zunächst auf einige Spezialitäten des Autors ein, die dieser bereits in "Alle Seelen" an den Tag gelegt habe. So spiele das Hypothetische eine große Rolle - weniger die Handlung selbst als das, was auch hätte sein können. Auch im vorliegenden Roman vermischen sich reale und fiktionale Welt, manche Personen der Geschichte gibt es wirklich, manche weisen Ähnlichkeiten mit ehemaligen Oxford-Kollegen Marias` auf, manche sind fiktional. Verbunden wird dies - so Buschmann - mit Reflexionen "über das Erzählen" und mit autobiografischen Aspekten, wie etwa dem pränatalen Tod seines älteren Bruders. Die Überlegungen, wie dessen Leben hätte verlaufen können, zählt Buschmann zu den "eindringlichsten" der bisher vom Autor verfassten Passagen. Zwar hat das Buch nach Ansicht des Rezensenten im ersten Drittel einige Längen. Allerdings werde der Leser durch Marias` " erhellendes Reflektieren über die Zeit, ihre Flüchtigkeit" durchaus entschädigt. Auch die Übersetzung durch Elke Wehr gefällt ihm ausgesprochen gut.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH