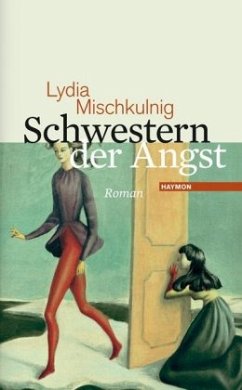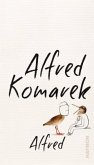Als Kinder sind Marie und Renate unzertrennlich. In einer Familie, die geprägt ist von Verlust und Misstrauen, schafft Renate für ihre Schwester eine eigene Welt aus der Sehnsucht nach Unversehrtheit und Glück. Doch dann, Jahre später, tritt Paul in das Leben der Mädchen und spaltet ihre vermeintliche Einheit. Von beiden umworben, entscheidet er sich für Marie - und plötzlich kippt die liebende Fürsorge Renates in Hass und subtil tobenden Zorn. Je tiefer der Graben zwischen den Frauen wird, umso gefährlicher verzerrt sich Renates Blick auf die Welt. Sie heftet sich dem Paar an die Fersen, verfolgt ihre Schwester, überwacht sie zuerst aus der Distanz, rückt dann aber unaufhaltsam näher - bis zur letzten Konsequenz.In kunstvoller Sprache und mit ungeschminktem Blick nimmt Mischkulnig die Perspektive Renates ein, eine Perspektive, in der sich Wirklichkeit und Paranoia überlagern.

Für die Geschichte einer biographischen Entgleisung braucht man erzählerische Balance. Ausgerechnet daran mangelt es Lydia Mischkulnigs Roman erheblich.
Dieser Erzählerin ist nicht zu trauen. Zunächst erscheint Renate, mit deren Stimme wir ihre Geschichte und die ihrer Familie erfahren, als ein Vorbild an Gewissenhaftigkeit. Ihren Job bei einer Werbefirma erfüllt sie mit Hingabe, sie ist engagiert, ja beflissen.
Bald aber regen sich Zweifel: Warum zum Beispiel ist Renate so auf ihre jüngere Schwester Marie fixiert? Warum muss sie, offenbar aufgrund einer Verordnung, zu deren Wohnung einen Abstand von mindestens dreißig Metern einhalten? Und warum bewahrt sie in ihrer Handtasche ein Skalpell auf?
Was wie ein nüchterner Bericht aus dem modernen Angestelltenalltag beginnt, nimmt schnell verstörende Züge an. Denn die scheinbar so selbstsichere Ich-Erzählerin verfällt immer wieder in einen seltsam altklugen Jargon, wie man ihn aus psychologischen Ratgebern kennt. Das klingt dann so: "Meine Sehnsucht war so groß nach der verlorenen Geborgenheit, wie wohl Kleinstkinder ihre Mutterinstanz vermissen." Die Diagnosen mögen stimmen, mit der Therapie ist es aber nicht weit her. Denn zwar kennt Renate einschlägige Vokabeln zur Eigendiagnose, befreien kann sie sich damit aus ihren Zwängen und Nöten aber ganz und gar nicht.
Allmählich formt sich aus den Bekenntnissen der so sehr um Normalität bemühten Erzählerin ein tristes Lebensbild, wie es holzschnitthafter kaum ausfallen könnte: Als Kleinkind wuchs Renate bei den Großeltern irgendwo im Osten Europas auf, während ihre Mutter als Putzfrau im reichen Westen ihr Glück und einen passenden Mann suchte.
Derweil bemühte sich die Großmutter, das Kind vor den Nachstellungen des lüsternen Opas zu beschützen. Kaum hatte die Mutter aber einen passenden Mann, einen soliden Österreicher, gefunden, starb sie auch schon bei der Geburt ihrer zweiten Tochter, die hinfort von der großen Schwester Renate großgezogen wurde. Unerfüllte Liebe, die Hilflosigkeit des gutmütigen Stiefvaters, Sehnsucht nach exklusiver Zuwendung und die Unfähigkeit, sich aus der eigenen Situation zu lösen, führen bei der Heranwachsenden zu einem ganzen Bündel von Problemen. Essstörungen und allergische Hautreaktionen gehören da noch zu den harmloseren Symptomen.
So klar die Zusammenhänge zwischen Kindheitstraumata und verpfuschter Erwachsenenexistenz erscheinen: Mischkulnig will die Pathologie ihrer Heldin behutsam und ohne moralische Direktiven zeigen. Dramaturgisch ist es allerdings riskant, die Ereignisse allein aus der Perspektive Renates zu schildern, nicht nur, weil sie eine unzuverlässige Chronistin ist. Die distanzierte Altklugheit, der stete Drang, die Umgebung zu bewerten: Diese sozialen und emotionalen Mängel erschweren die Empathie für die Figur beim Leser.
Dies könnte Teil des Verfahrens sein, gäbe es einen Kontrapunkt zu Renates Verfallsgeschichte. Aber auch für ihre Opfer entwickelt man wenig Sympathie. Die kluge Schwester Marie, deren Partner Paul, der attraktive Nervenarzt, oder Robert, der ewige Verlierer, mit dem Renate mehr aus Mangel an Alternativen denn aus Liebe ein pragmatisches Verhältnis verbindet: Ihnen allen fehlt eine erzählerische Instanz, um sie als Opfer von Renates Beziehungswahn und damit als komplexe Figuren zu vermitteln. Sie bleiben Schablonen, gespiegelt in der verzerrten Wahrnehmung der Erzählerin. Selbst als Renate gewalttätig wird, inklusive Skalpell- und Klebstoff-Einsatz, verdichtet sich die Geschichte nicht zum plausiblen Psychogramm. Zu skurril bleiben die Attacken, zu blass die Opfer.
Mag sein, dass dies alles auf Kalkül beruht. Lydia Mischkulnig, die 1962 in Klagenfurt geboren wurde und heute in Wien lebt, ist eine versierte und experimentierfreudige Autorin. Für ihre Erzählungen und Romane - etwa das biographische Verwirrspiel "Umarmungen" (2002), das mit Ingeborg Bachmanns "Malina" verglichen wurde - hat sie etliche Auszeichnungen erhalten. Diesmal soll die Wahrnehmung einer psychisch Kranken mit dem Phänomen des Stalking kurzgeschlossen werden. Das Ergebnis ist leider weder der spannende Thriller, den der Klappentext verspricht, noch eine psychologische Fallstudie über aggressiven Verfolgungswahn. Stattdessen bleiben diese "Schwestern der Angst" ein seltsamer Zwitter, teils drastische Karikatur, teils flache Kolportage.
SABINE DOERING
Lydia Mischkulnig: "Schwestern der Angst". Roman.
Haymon Verlag, Innsbruck 2010. 244 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Die Experimentierfreude der Autorin in Ehren, aber was Lydia Mischkulnig hier zusammengebraut hat, überzeugt Sabine Doering weder als der im Klappentext angekündigte Thriller noch als psychologische Fallstudie. Schuld daran ist laut Doering vor allem die Erzählerfigur, eine Frau aus prekärsten Verhältnissen, die der Rezensentin sowohl mit ihrer Selbstdiagnose als auch mit ihrer Selbsttherapie völlig überfordert erscheint. Doering schildert das als erzählerisches Problem, nicht als Problem der Figur. Es fehlt also eine souveräne Instanz, die dem Text verlässlich Tiefenschärfe verleiht. So gerät die als nüchterner Alltagsbericht beginnende Geschichte in den Augen der Rezensentin immer mehr zum finsteren Albtraum, weniger für die Figur, als für den Leser.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Schwestern lieben und hassen einander. Selten noch haben sie das so bedingungslos getan wie im neuen Roman der österreichischen Schriftstellerin Lydia Mischkulnig. ,Schwestern der Angst' heißt das Werk, das vor inniger Offenheit nicht zurückschreckt." www.welt.de, Paul Jandl "Lydia Mischkulnig, eine literarische Spezialistin des eskalierenden Familienschreckens, bietet zwei Schwestern auf, die in symbiotischer Enge aufgewachsen sind, so dass ihre Trennung die eine nicht wirklich befreit und die andere in den Amoklauf treibt. Die Atmosphäre ist den ganzen Roman über beklemmend, stickig, und absichtsvoll sind alle Dinge, selbst das Verhältnis von Gewalt und Lust, in der Schwebe gehalten. Die Hölle, das müssen zwei Schwestern sein." Neue Zürcher Zeitung, Karl-Markus Gauß "'Schwestern der Angst' gelingt Lydia Mischkulnig als eindringliches Psychogramm; sie schafft eine interessante Darstellung von Sehnsucht und Rachlust, die ausführliche Schilderung eines gefährlichen Schwankens von Nähe und Distanz, Zuneigung und Abneigung, Schutz und Kontrolle ..." Der Standard, Klaus Zeyringer " ... ein Thriller, der alle, die in ihrer Lektüre nach anspruchsvoller Spannung suchen, nicht enttäuschen wird. Zugleich ist 'Schwestern der Angst' aber auch ein subtiles Psychogramm dessen, was im Inneren der Menschen beschädigt wird, wenn sie eine kaputte Kindheit durchstehen mussten (...) so wie das Skalpell, das Renate immer in der Handtasche mit sich führt, so geht auch dieses außergewöhnliche Buch unter die Haut." Wiener Zeitung, Uwe Schütte " ... höchst intelligent gestalteter Psycho-Krimi ..." Oberösterreichische Nachrichten, Christian Schacherreiter " ... ein zunehmend tempo-, action- und gewaltreicher Amoklauf ... mit gut dosiertem schwarzem Humor ... sprachmächtige Literatur ist das, die von Macht und Ohnmacht in Familien handelt, sich aber nicht trostlos liest, sondern auf schön böse Weise unterhält." Falter, Sebastian Fasthuber "Seit Elfriede Jelineks 'Die Klavierspielerin' (1983) hat man Derartiges nicht mehr gelesen." APA, Wolfgang Huber-Lang "Ein raffiniert aufgebauter Beziehungsroman über Mann-Frau-Machtverhältnisse, der als schwarzhumoriger Psychothriller endet." WOMAN "In 'Schwestern der Angst' zeichnet die in Wien lebende Kärntnerin Lydia Mischkulnig ein detailliertes Psychogramm einer verletzten, einsamen Frau." KURIER, Emily Walton "Atemloser Wechsel zwischen Nähe und Distanz, Missbrauch, Ohnmacht und Vergeltung ... sehr zu empfehlen." Bibliotheksnachrichten, Christina Repolust