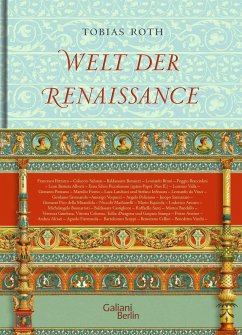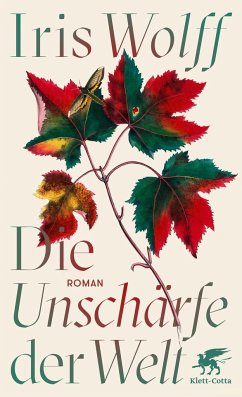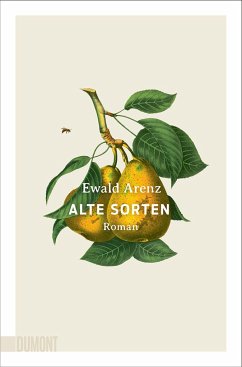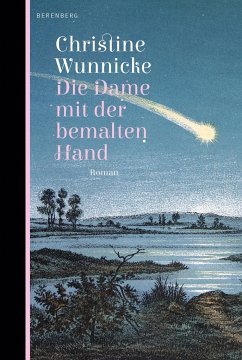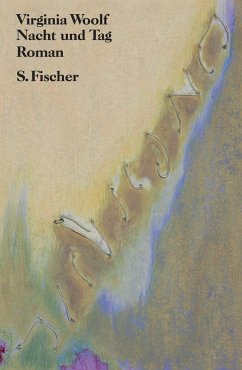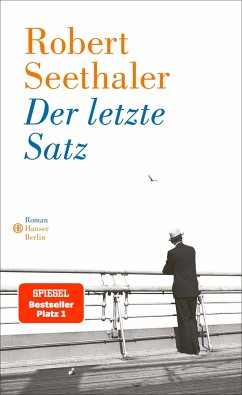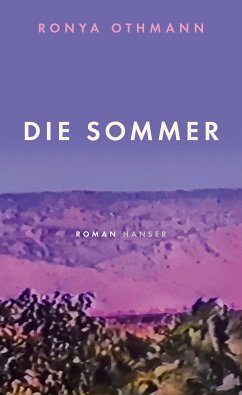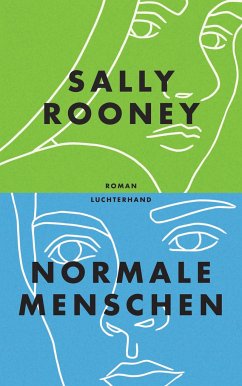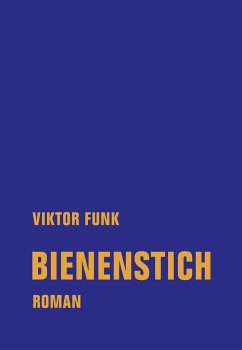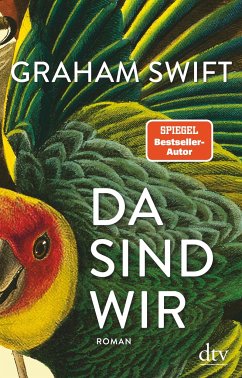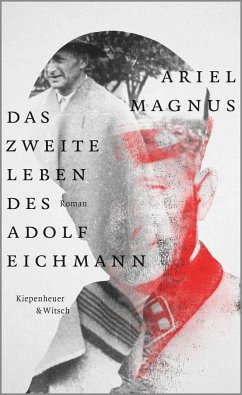Schwitters
Roman

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis - Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst in dunklen ZeitenWie fängt man eine Zukunft an, die eigentlich schon aufgehört hat? Mit einem Streifen Meer zwischen sich und seiner Heimat, seiner Sprache, sich selbst? Kurt Schwitters ist 49, als ihn die Nationalsozialisten zur Flucht aus Hannover zwingen. Sein Erfolg, Werk, Besitz, die Eltern und seine Frau Helma bleiben zurück. Die Kunst weicht der Kunst des Überlebens. In Norwegen, London und endlich dem Lake District beginnt Schwitters' zweites Leben in fremder Sprache....
Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis - Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst in dunklen Zeiten
Wie fängt man eine Zukunft an, die eigentlich schon aufgehört hat? Mit einem Streifen Meer zwischen sich und seiner Heimat, seiner Sprache, sich selbst? Kurt Schwitters ist 49, als ihn die Nationalsozialisten zur Flucht aus Hannover zwingen. Sein Erfolg, Werk, Besitz, die Eltern und seine Frau Helma bleiben zurück. Die Kunst weicht der Kunst des Überlebens. In Norwegen, London und endlich dem Lake District beginnt Schwitters' zweites Leben in fremder Sprache. Wantee, die neue Frau an seiner Seite, hält ihn auf Kurs und seinen Kopf über Wasser, selbst als der Wortkünstler verstummt. Im Merzbau hat Schwitters einen anderen Weg gefunden, um Himmel und Heiterkeit, das Funkeln der Wiesen und die Durchsichtigkeit der Luft einzufangen. Mit irrwitziger Disziplin, bis zur Erschöpfung. Wer ihn dabei beobachtet, begreift: Kunst bildet die Welt nicht nach. Sie übersetzt sie in Formen, die uns berühren.
In ihrem Roman folgt Ulrike Draesner dem Schriftsteller und bildenden Künstler Kurt Schwitters ins Exil. Es sprechen Kurt, seine Frau, sein Sohn, seine Geliebte. In einer virtuosen Mischung aus Fakten und Fiktion entsteht das Panorama einer Zeit, in der angesichts einer brennenden Welt neu um Freiheit und Kultur gerungen wird. Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst, darüber, wie sie entsteht und was sie vermag.
Ausstattung: Mit farbigem Poster im Umschlag
Wie fängt man eine Zukunft an, die eigentlich schon aufgehört hat? Mit einem Streifen Meer zwischen sich und seiner Heimat, seiner Sprache, sich selbst? Kurt Schwitters ist 49, als ihn die Nationalsozialisten zur Flucht aus Hannover zwingen. Sein Erfolg, Werk, Besitz, die Eltern und seine Frau Helma bleiben zurück. Die Kunst weicht der Kunst des Überlebens. In Norwegen, London und endlich dem Lake District beginnt Schwitters' zweites Leben in fremder Sprache. Wantee, die neue Frau an seiner Seite, hält ihn auf Kurs und seinen Kopf über Wasser, selbst als der Wortkünstler verstummt. Im Merzbau hat Schwitters einen anderen Weg gefunden, um Himmel und Heiterkeit, das Funkeln der Wiesen und die Durchsichtigkeit der Luft einzufangen. Mit irrwitziger Disziplin, bis zur Erschöpfung. Wer ihn dabei beobachtet, begreift: Kunst bildet die Welt nicht nach. Sie übersetzt sie in Formen, die uns berühren.
In ihrem Roman folgt Ulrike Draesner dem Schriftsteller und bildenden Künstler Kurt Schwitters ins Exil. Es sprechen Kurt, seine Frau, sein Sohn, seine Geliebte. In einer virtuosen Mischung aus Fakten und Fiktion entsteht das Panorama einer Zeit, in der angesichts einer brennenden Welt neu um Freiheit und Kultur gerungen wird. Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst, darüber, wie sie entsteht und was sie vermag.
Ausstattung: Mit farbigem Poster im Umschlag