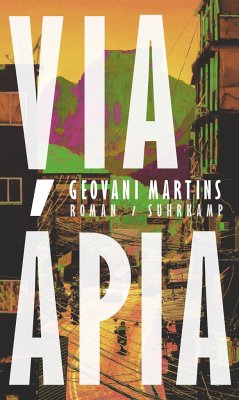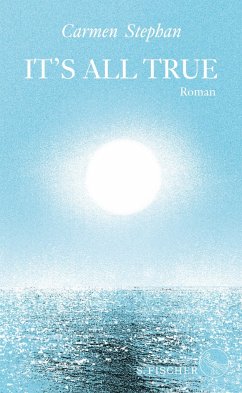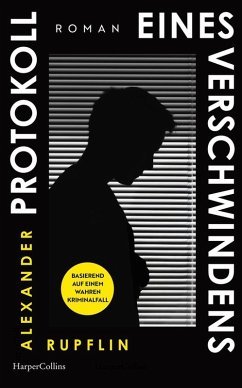Nicht lieferbar

Sechzehn Frauen
Geschichten aus Rio
Übersetzung: Kultzen, Peter
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Sechzehn Frauen, eine Stadt: eine unwiderstehliche Liebeserklärung an die Schönheit von Rio!Renata, Helena, Cíntia, Graziela, Rosana... Sie haben Träume, Affären, die eine oder andere kleine Meise, und alle wohnen sie in Rio. Sechzehn Frauen zwischen 6 und 93 Jahren feiern in diesem bunten Panorama den Zauber ihrer Stadt: Jede von ihnen lässt Rafael Cardoso mit ganz eigener Stimme von ihrem Viertel erzählen - von der Copacabana über Ipanema über das Zentrum zu den Vororten und wieder zurück. Während Helena mit einem Dealer durchbrennt, jubelt Renata ihrem untreuen Mann ein Baby unte...
Sechzehn Frauen, eine Stadt: eine unwiderstehliche Liebeserklärung an die Schönheit von Rio!
Renata, Helena, Cíntia, Graziela, Rosana... Sie haben Träume, Affären, die eine oder andere kleine Meise, und alle wohnen sie in Rio. Sechzehn Frauen zwischen 6 und 93 Jahren feiern in diesem bunten Panorama den Zauber ihrer Stadt: Jede von ihnen lässt Rafael Cardoso mit ganz eigener Stimme von ihrem Viertel erzählen - von der Copacabana über Ipanema über das Zentrum zu den Vororten und wieder zurück. Während Helena mit einem Dealer durchbrennt, jubelt Renata ihrem untreuen Mann ein Baby unter, während Jamilly als Drogenkurierin anheuert, stürzt Bel in eine tiefe Krise, als sie das erste graue Haar an sich entdeckt. Und fast alle Frauen kennen einen gewissen Rafael... Eine opulente Hommage an Rio, das erst seine Frauen zu dem machen, was es ist: eine der aufregendsten Metropolen der Welt.
Renata, Helena, Cíntia, Graziela, Rosana... Sie haben Träume, Affären, die eine oder andere kleine Meise, und alle wohnen sie in Rio. Sechzehn Frauen zwischen 6 und 93 Jahren feiern in diesem bunten Panorama den Zauber ihrer Stadt: Jede von ihnen lässt Rafael Cardoso mit ganz eigener Stimme von ihrem Viertel erzählen - von der Copacabana über Ipanema über das Zentrum zu den Vororten und wieder zurück. Während Helena mit einem Dealer durchbrennt, jubelt Renata ihrem untreuen Mann ein Baby unter, während Jamilly als Drogenkurierin anheuert, stürzt Bel in eine tiefe Krise, als sie das erste graue Haar an sich entdeckt. Und fast alle Frauen kennen einen gewissen Rafael... Eine opulente Hommage an Rio, das erst seine Frauen zu dem machen, was es ist: eine der aufregendsten Metropolen der Welt.