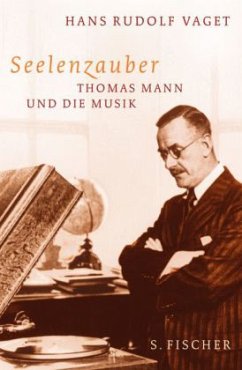Die privilegierte Stellung der Musik im Werk Thomas Manns erschließt sich erst durch eine prismatische Betrachtungsweise, die in vielfältigen Brechungen ihre schlüsselhafte Bedeutung für das Verständnis der deutschen Katastrophe in den Blick zu rücken vermag. Dieser Ansatz erfordert separate Kapitel nicht nur zu den dominanten Gattungen des Kunstlieds und des Musikdramas, sondern auch zu dem Dreigestirn der maßgebenden Komponisten: Wagner, Strauss und Pfitzner. Als ebenso gewichtig und erhellend erweist sich das jeweils sehr unterschiedliche Verhältnis zu den großen Dirigenten Bruno Walter und Wilhelm Furtwängler sowie zu den führenden Wagnerianern seiner Zeit: Franz W. Beidler, Ernest Newman und Theodor W. Adorno.

Seelenzauber: Zwei Bücher über Thomas Mann und die Musik / Von Eckhard Heftrich
Zu dem durchaus überschaubaren Kreis der Granden der Thomas-Mann-Forschung zählt seit langem Hans R. Vaget. Den 1938 geborenen deutschen Germanistikstudenten zog es früh in die Vereinigten Staaten, wo er als Professor für deutsche Literatur und Komparatistik reüssierte. Zu seinem steten Interesse an Thomas Mann kam die immer intensivere Erkundung jener Musik, die schon Thomas Manns Leidenschaft und Leiden ausgemacht hatte. Zu erwarten war, daß Vaget seine weitverstreuten Aufsätze einmal zusammenführen werde.
Das nun vorgelegte Buch sprengt aber den Rahmen üblicher Sammelbände; und nicht nur, weil das bereits Publizierte ergänzt oder verändert wurde. Und auch nicht, weil es sich bei einem Drittel der insgesamt fünfzehn Kapitel um Erstveröffentlichungen handelt. Sondern, weil alle Beiträge nun als detailreiche Beweis-Facetten einer zentralen Interpretationsthese erscheinen. Sie läuft zwar unter der abgenutzten Titulatur "Mentalitätsgeschichte". Aber Vagets Experiment, eine von der Geschichtswissenschaft auf so ganz anderen Feldern entwickelte Praxis auf ein geistesgeschichtliches Individualobjekt zu übertragen, ist aller Aufmerksamkeit wert.
Wenn es von älteren Beiträgen heißt, sie seien "auf den neuesten Stand gebracht worden", so ist damit mehr gemeint als nur die Einbeziehung neuerer Diskurse samt jüngerer Sekundärliteratur. Es geht vielmehr darum, nachträglich die Einheit unter dem Primat des Generalthemas herzustellen. Das läuft nicht ohne Reibungen ab.
Da für Thomas Mann stets die Musik das Paradigma der Kunst, und das heißt natürlich: seiner eigenen, war, muß sich die Tragfähigkeit der auf ihn angewandten Theorie in der Neuinterpretation des seit Jahrzehnten traktierten Themas " . . . und die Musik" bewähren. Nach Vagets Überzeugung ist es in der Tiefenschicht kaum berührt worden, weil nicht erkannt wurde, daß Thomas Manns Werk die Musikidolatrie und deren so verhängnisvolle politische Folgen offenlegt. Er hatte sich dieser Vergötzung einmal selbst anheimgegeben, sie aber zu überwinden vermocht. Wagner erscheint als Zentralgestirn und zugleich als Stern des Unheils. "Seelenzauber mit finsteren Konsequenzen": So heißt es bereits im "Zauberberg" ebendort, wo der Bogen von Schubert zum Welteroberer Wagner gespannt, aber noch an Nietzsche als den zukunftsmächtigen Selbstüberwinder geglaubt wird. Da schon hier deutsche Seelen- und Geistesgeschichte sich spiegeln, muß ihre Offenbarung in dem vom Autor selbst zu seinem "Parsifal" erklärten "Doktor Faustus" zu finden sein.
Dem wird man nicht so einfach widersprechen mögen. Wohl aber stellen sich grundsätzliche Fragen, wenn das Werk von Thomas Mann so rigoros wie hier als "Mentalitätsgeschichte" gelesen und damit auch der alleingültige Maßstab für die Tauglichkeit bisheriger Interpretationen gesetzt wird. Tatsächlich sagt Vaget, es scheine an der Zeit zu sein, das Werk "aus seiner germanistischen Ghettoisierung herauszuführen und in den breiten Strom des fachübergreifenden Nachdenkens über Deutschland und seine Geschichte zurückzuholen". Die Beschleunigung im Wandel der Thomas-Mann-Forschung soll sich vor allem "in Folge der Neukonstitution Deutschlands als postklassischem Nationalstaat" ereignet haben.
Gewiß haben die Ereignisse von 1989/90 die Germanisten weder im Osten noch im Westen kaltgelassen. Zu einer Revision der davor gewonnenen Erkenntnisse über Thomas Mann bestand aber gewiß kein Anlaß, wenn diese Erkenntnisse in Erfahrungen wurzelten, die noch in den bewußt erlebten letzten Jahren des Hitlerreichs zu einer nie verblassenden politischen Sensibilisierung geführt hatten. Wenn nun das Werk zureichend allein vor dem Horizont der Geschichte der deutschen Mentalität erklärt werden kann, muß es selbst originäre, quasi objektive Mentalitätsgeschichte sein. Konsequenterweise macht Vaget daher Thomas Mann zum Großmeister der Mentalitätsgeschichte, natürlich avant la lettre, von Deutschland und den Deutschen. Und wiederum ist es nur konsequent, daß der das Leben und Werk resümierende Musik-Roman mit seinem "Nexus" von Musik und Geschichte ins Zentrum rückt.
Die Frage nach den "Beziehungen zwischen deutscher Musik und deutscher Identität" soll im neunzehnten Jahrhundert ein "beträchtliches Maß an metapolitischer Dringlichkeit" erhalten haben, um schließlich im zwanzigsten katastrophisch zu kulminieren. Darum habe Thomas Mann die politischen Konsequenzen sowohl der individuellen als auch der kollektiven Musikidolatrie im "Faustus"-Roman "manifest zu machen versucht". Versucht!? Doch wenig spricht dafür, daß hier ein Selbstzweifel Vagets hervorschimmert. Denn gerade die vielen Zitate sind, wie schon jene aus dem "Zauberberg", stets passend verkürzt. Bereits Settembrinis Parole, die Musik sei "politisch verdächtig", wird so zugeschnitten, daß die kontextuelle Ironie verdunstet, die der Figur des lungenkranken Fortschrittsrhetors erst den Sauerstoff zum Leben gibt. Gravierender noch, wenn zum Beispiel von Leverkühns "Bonmot", daß Kaisersaschern Weltstadt werden möchte, gesagt wird, das klinge distanzierter, als es von des Komponisten "eigener Gesinnung her gerechtfertigt werde", verfolge dieser doch "ein ähnliches Ziel, nämlich die musikalische Hegemonie". Dabei prophezeit Leverkühn hier, aus dem Traum von der Weltstadt Kaisers-aschern werde nichts.
Eine der von Thomas Mann nur dürftig übermalten Bruchstellen der tragenden "Faustus"-Konstruktion wird vollends unsichtbar gemacht, wenn die verkürzte Teufelsverheißung: "Du wirst führen, du wirst der Zukunft den Marsch schlagen" mit einer Bemerkung Schönbergs verbunden wird, der zufolge durch die Entdeckung der Dodekaphonie die Vorherrschaft der deutschen Musik für die nächsten hundert Jahre gesichert sei. Indessen gehört alles, was dem zitierten Halbsatz folgt oder ihm vorangeht, zum prekären Nietzsche-Komplex. Die "Buben", die auf den Namen dessen "schwören", der der Zukunft den Marsch schlägt, werden, sobald Thomas Mann Nietzsche eindeutiger "im Lichte unserer Erfahrung" herausstellt, kenntlich gemacht als jene Typen, die mit dem tragischen Philosophen dasselbe politische Spiel getrieben haben wie Hitler mit Bayreuth. Gestehen zu müssen, daß Wagner wie Nietzsche ihrer zukünftigen Verhunzung selber den Weg bereitet haben, hat den Autor des "Faustus" an beiden leiden lassen.
Der Riesenbau des "Faustus" ist auf dem noch dem Fin de siècle entstammenden Nietzsche-Fundament erwachsen. Auf eine gründliche Prüfung der Statik des Romans konnte Vaget sich nicht einlassen, ohne Gefahr zu laufen, auch auf Risse seiner mentalitätsgeschichtlichen Zuordnung zu stoßen. Nachdenklich stimmt die Gereiztheit der Reaktion auf Joachim Kaisers "Faustus"-Interpretation; aber auch etwa die Art, wie ältere, subtile Deutungen von "Zauberberg" und "Faustus", en passant und anonymisiert, zur bloßen Einflußphilologe herabgestuft werden. Denn auch sie stehen quer zu der mentalitätsgeschichtlichen Hypothese. Es bleibt doch sehr die Frage, ob bei der desaströsen Politik, die 1914/18 bereits ihre blutige Katastrophen-Orgie feierte, das Gewaber von der Suprematie der deutschen Musik wirklich ursächlich mitbestimmend oder doch nur ein Teil des ideologischen Begleitrauschens war.
Allen kritischen Anmerkungen zum Trotz - das Fazit des rezensierenden Kollegen lautet: Es handelt sich bei diesem Buch um die wohl bedeutendste Thomas-Mann-Publikation des vergangenen Jahrzehnts (von der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe, zu deren aktivsten Herausgebern Vaget gehört, einmal abgesehen); dies weniger wegen des großen Anregungs- und Provokationspotentials als vielmehr wegen der Präsenz einer nur in Jahrzehnten zu gewinnenden Fülle des Wissens.
Dem anhaltenden Mann-Boom ist es wohl zu verdanken, daß die Scripts einer sich über 26 Folgen hinziehenden Rundfunk-Sendereihe von 2005 nun auch gedruckt erschienen sind. Unbegreiflich ist, daß der Verfasser, Volker Mertens, die Gelegenheit nicht wahrgenommen hat, seine Kommentare noch einmal zu überprüfen. Denn nicht nur feiern längst dahingegangene Klischees hier en masse eine fröhliche Auferstehung. Schwerer noch wiegt die Menge von Fehlinformationen etwa folgender Art: "Die Episode vom unbeabsichtigten Bordellbesuch ist aus einem Brief Nietzsches entnommen." (Sie stammt freilich aus Paul Deussens späten "Erinnerungen an Nietzsche".) Wie Nietzsche "sieht Adrian ein Klavier und schlägt ein paar Töne darauf an. Es ist die Folge h e a e es, Haetera Esmeralda bedeutet sie. Sie wird wieder im letzten Werk Adrians auftauchen."
Hier nun muß man, um zu entdecken, was da durcheinandergeraten und falsch ist, nicht einmal die Sekundärliteratur bemühen. Es genügt, die einschlägigen Stellen im sechzehnten und im neunzehnten Kapitel des Romans aufzuschlagen. Für Hörer, deren Kenntnisse möglicherweise vor allem auf Verfilmungen und Fernsehen beruhen, kam es auf dergleichen nicht an, sie durften besten Gewissens ungetrübt den langen Originalzitaten und den schönen Musikbeispielen lauschen. Aber Studenten, die auch in Zukunft noch Seminararbeiten über das Musikthema schreiben werden, sollten bei der Benutzung des Buches einige Vorsicht walten lassen.
Hans Rudolf Vaget: "Seelenzauber". Thomas Mann und die Musik. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006. 512 S., geb., 22,90 [Euro].
Volker Mertens: "Groß ist das Geheimnis". Thomas Mann und die Musik. Mit CD. Militzke Verlag, Leipzig 2006. 272 S., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Alles in allem sehr aufschlussreich findet der Rezensent Manfred Koch diese Studie, die sich mit dem Verhältnis Thomas Manns zur Musik auseinandersetzt. Ja, mehr noch, in diesem Verhältnis eine Auseinandersetzung mit der verhängnisvollen Nationalprojektion der Deutschen erkennt. Thomas Mann kannte den Rausch der Musik - in Wagner am eindrucksvollsten verkörpert - und erkannte spät, aber dann umso deutlicher die Gefahr, die darin liegt, sich kollektiven Verschmelzungsorgien zu überlassen. Vagets mentalitätsgeschichtliche Lesart des "Doktor Faustus", die den Roman eher als Antizipation denn als schlichte Allegorie der Barbarei begreift, kann den Rezensenten überzeugen. Umso erstaunlicher findet er freilich die Tatsache, dass etwa die mentalitätsgeschichtlich so bedeutende Rolle des Protestantismus im Vergleich dazu viel zu wenig beleuchtet wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH