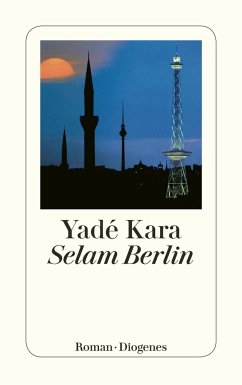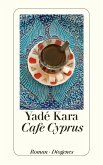Die Geschichte Hasans, neunzehn, der mit seiner Familie jahrelang zwischen Bosporus und Spree hin- und hergependelt ist und der am Tag des Mauerfalls beschließt, Istanbul zu verlassen und ganz nach Berlin zurückzukehren. Ein atemberaubend tragikomischer Roman voll farbigster Charaktere und Episoden aus Ost und West. Er handelt vom Erwachsenwerden, von Freundschaft, von der Suche nach der großen Liebe, von Verrat und Identität. Ein kosmopolitisches Buch, das Klischees aufzeigt und zerstört.

Was in den ersten Wochen geschah, als Berlin wieder zusammenwuchs und dabei immer größer wurde? Der Türkin Yadé Kara ist dazu ein Schelmenroman eingefallen.
VON FRANZ JOSEF GÖRTZ
Osman Kavalci? Wunderschöne Geschichten hätten sich von dem erzählen lassen, wenn noch Zeit gewesen wäre und ausreichend Platz für Nachträge, Anmerkungen oder Anekdoten.
Doch der Platz hat leider nicht ausgereicht, sagt Yadé Kara achselzuckend und erzählt zum Trost vom Kinderbauernhof an der Adalbertstraße, den es schon gab, als die Mauer noch stand: "Hier war sie", sagt Yadé, bleibt stehen und läuft dann ungeduldig voraus wie ein Mädchen, das seine Puppe verloren und nach Jahr und Tag immer noch nicht gefunden hat. Die Berliner Mauer ist verschwunden, fast spurlos, wenn auch nicht über Nacht. Liefert das ausreichend Stoff für einen Roman, der natürlich weder pathetisch sein darf noch eine Kolportage?
Yadé streckt die Hand aus und deutet auf das Trümmerfeld vor der Kirche am Bethaniendamm: "Das war der Garten von Osman Kavalci." Ein Türke? Nicht ungewöhnlich, mitten in Kreuzberg. Bevor die Mauer fiel, stand regelmäßig etwas über ihn in der Zeitung, sagt sie. Beispielsweise, daß er zum Inventar der Berliner Mauer gehörte und ein Original der Art war, wie es sie am Ende der achtziger Jahre nur noch selten gab. Ein Türke von Geburt, aber ein Berliner von Natur, nicht auf den Kopf gefallen - und auch nicht auf den Mund. Nicht daß er ein Freund der DDR-Grenzer gewesen wäre. Aber mit denen hat er von früh bis spät geredet, manchmal über die Mauer, manchmal über sie hinweg. Nicht unbedingt eine tragende Rolle - aus dem Blickwinkel einer Schriftstellerin, die schließlich an den Fortgang der Weltgeschichte denken muß, wenn sie von der Gegenwart Berlins und seiner Zukunft erzählen will. Aber schillernde Charaktere sind in allen Büchern willkommen, erst recht natürlich, wenn sie einmal nicht frei erfunden sind. Oder?
Solange keine Antwort kommt, darf weitergefragt werden: nach Hasan Selim Khan Kazan und seinem Bruder Ediz zum Beispiel, die in Yadé Karas Berlin allemal Kanaken, in Istanbul dagegen grundsätzlich Almancis genannt werden. Oder nach Baba, ihrem Vater, der unbelehrbar dem Marxismus anhängt, zu seiner kugelrunden Frau daheim Täubchen sagt, aber eine uneingestandene Schwäche für Blondinen hat. Oder nach Babas bestem Freund Halim, der Zigarren raucht wie Castro und Che Guevara, sonst Breschnew sehr ähnlich sieht, als Büroschmuck aber nur ein Porträt von Atatürk gelten läßt. Sie alle sind teils Hauptdarsteller, teils vielbeschäftigte Komparsen im Buch "Selam Berlin". Ein durchaus frohlockendes Hallo, das sie der Stadt zurufen. Falls sie nicht aus dem wirklichen Leben gegriffen sein sollten, haben sie lange genug darauf warten müssen, endlich zwischen zwei Buchdeckel einzurücken und als kleinbürgerliche Helden in der fremden Heimat Furore zu machen - wie ihr Landsmann Osman Kavalci auf seine Weise ebenso.
Es hat einige Überredungskraft gekostet, ihrer Schöpferin einen Besuch in Kreuzberg einzureden und einen Gang durch das Viertel abzutrotzen, in dem der Roman spielt. "Selam Berlin" ist ihr literarischer Erstling, vor ein paar Tagen erst an den Buchhandel ausgeliefert. Über die skurrilen Gestalten, die kunterbunten Schauplätze, von denen sie erzählt, gibt sie gern Auskunft - aber doch nicht darüber, welche davon der Wirklichkeit nachempfunden und welche frei erfunden sind. Auch von ihrem eigenen Leben erfährt man bloß das Nötigste und nur auf hartnäckiges Befragen. Wenn sie nicht schweigt, winkt sie ab oder verliert zwei Sätze, die große Scheu verraten und ihre Unsicherheit nicht kaschieren. Sie ist 38 Jahre alt, stammt aus der Stadt Cayirli in der Osttürkei, hat als Schauspielerin, Lehrerin und Journalistin gearbeitet und zwischendurch ein Textilunternehmen gemanagt. Sie berlinert gern, wenn sie von sich spricht, und sieht dann deutlich jünger aus: wie die widerstrebend erwachsen gewordene Schwester ihres Protagonisten Hasan Selim Khan, der gerade 19 ist, als die Mauer fällt und der Roman beginnt.
Wir treffen Yadé in der Gaststätte auf dem Fernsehturm. Dort oben, hatte sie versprochen, könne man sich zunächst einen Überblick verschaffen: über die neue Mitte und die Weiterungen an den Rändern. Der Aufstieg zu Gastronomie und lärmender Ungemütlichkeit ist nur mit dem kostenpflichtigen Lift möglich, der Zugang zum Restaurant durch einen streng dreinblickenden Türsteher gesichert. Solches Personal kam schon in der Vergangenheit bevorzugt aus Sachsen. Der Dialekt tut verläßlich seine Wirkung wie früher an der unvergänglich so genannten Zonengrenze: Man fügt sich und bildet ohne Murren eine Schlange, obwohl Tische genug frei wären. In Ost-Berlin war man es nicht anders gewohnt, und den West-Berlinern ist es vertraut. Darum lächelt Yadé geduldig und bringt uns umso nachdrücklicher in Erinnerung, wenn die Schlange sich lange Zeit nicht bewegt. Doch der authentische Berliner Zungenschlag verfängt hier wenig, so verbindlich er sonst klingt und so apart er der Dichterin zu Gesicht steht.
Wenn man den Berliner Originalton dazunimmt, ist sie viersprachig aufgewachsen, erzählt sie, während das Restaurant sich geräuschvoll und betulich um die eigene Achse dreht. Daheim hat sie den Zaza-Dialekt gelernt, der in der östlichen Türkei von einer Minderheit gesprochen wird. Mit ihren Eltern und den Geschwistern dagegen hat sie Türkisch und, später in Berlin, Deutsch geredet. Die immer ein wenig frivol anmutende Berliner Denk- und Lebensart scheint Hasan mit allen idiomatischen Besonderheiten von ihr gelernt zu haben, auch wenn sie sich so provozierend derb wie er niemals ausdrücken würde. Die Sprüche jedenfalls, die sie ihrem Hasan in den Mund legt, lassen wenig Zweifel zu: Die sind der kruden Wirklichkeit abgelauscht und ohne viel Federlesens zu Papier gebracht - mit einem Beiklang, der viel Witz verrät und eine hintergründig ausgeprägte Neigung zur Selbstironie. Daß man im Lektorat des Diogenes-Verlags lange Zeit angenommen hat, daß "Selam Berlin" auf jeden Fall ein Mann geschrieben habe, berichtet die Autorin nicht ohne Genugtuung. Mag auch sein, daß da ein wenig Stolz mitschwingt, den Chauvi-Ton der "Berlinlis", wie sich die Kreuzberger Jungtürken selbst nennen, so genau getroffen zu haben.
Sie hat an der Freien Universität Anglistik und Germanistik studiert und nach dem Magisterexamen mit den Jobs mehrfach auch die Städte gewechselt, in denen sie das richtige Leben probieren wollte: Berlin, London, Istanbul, Hongkong - und am Ende, gewiß ein Zeichen großer Zuneigung, abermals Berlin. Lehrerin habe sie ursprünglich nie werden wollen, sagt sie mit einer geringschätzigen Handbewegung, "das hat sich in London und Istanbul einfach so ergeben". Auch das Schreiben? Im Prinzip schon, aber sehr unernst und ziemlich beiläufig. In Hongkong, bei einem Kaffee, ist ihr das erste Kapitel eingefallen, "und ich habe es dann gleich aufgeschrieben, weil ich alles so deutlich vor mir sah - die zentralen Figuren, das Haus, in dem Hasans Familie wohnt, und die Story, die alles miteinander verknüpft. Auch der Schluß stand früh fest", erzählt sie, "natürlich nicht ausformuliert, aber in Umrissen allemal." Solche literarischen Fertigbautechniken werden vermutlich in poetischen Selbsthilfekursen unterrichtet - aber Yadé hat dort immerhin gelernt, wie man sich auf dem Buchmarkt bewegt, solange man ein unbeschriebenes Blatt ist. Der Diogenes-Verlag hat postwendend geantwortet: Im Fall von "Selam Berlin" vielleicht ein Hinweis auf literarische Qualität. Der Fall der Mauer, von einem vorgereiften Türkenjungen nacherzählt - diese Perspektive gab's noch nicht oft.
Durch Kreuzberg bewegen wir uns zu Fuß, vom Kottbusser Tor durch die Adalbertstraße auf den Engeldamm zu, wo die Mauer zwei Straßen lang von West nach Ost verlief und wo Kreuzberg aufhört und Berlin-Mitte beginnt. Hasans Viertel sieht am frühen Vormittag reichlich abgeräumt aus, wie eine Kulisse, die seit den späten achtziger Jahren nicht mehr bespielt wird. "Für mich und Kazim und andere Jungs aus der Adalbertstraße war Kreuzberg out", erzählt Hasan in einem der letzten Kapitel des Romans. "Es war jetzt der Ort, wo die Eltern wohnten." Die Generationen haben gewechselt, und sie prallen nicht mehr auf engstem Raum aufeinander, sondern rücken voneinander ab, wie es scheint. "Es begann an einem Donnerstag abend im November 89", heißt es zu Beginn. "Und von da an war nichts mehr so, wie es einmal gewesen war."
Der Fall der Mauer, am Fernsehgerät in Istanbul miterlebt, ist im Roman "Selam Berlin" nicht mehr als eine Anekdote. Yadé Kara erzählt sie aus der Warte des nachfolgenden Jahrtausends, ganz ohne das geläufige Pathos, mit der schnoddrigen Emphase eines Türkenjungen, der sich, im Brustton der Überzeugung, als Berliner artikuliert und ahnt, daß mit jenem denkwürdigen Abend im November des Jahres 1989 die mauergeschützte Heimeligkeit dahin ist und seine türkisch-deutsche Identität einen düsteren Schatten, wenn nicht einen abgrundtiefen Riß bekommen hat: denselben Riß wie sein Vater Baba übrigens - wenn auch aus Gründen, die einen Schelmenroman angemessener erscheinen ließen als ein Vereinigungs-Rührwerk.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main