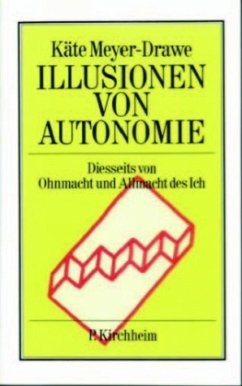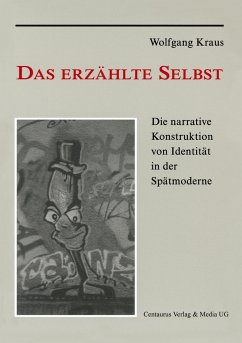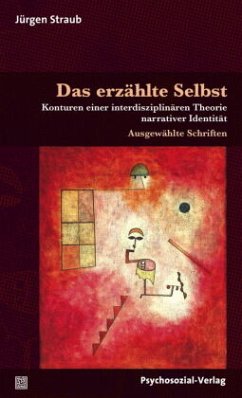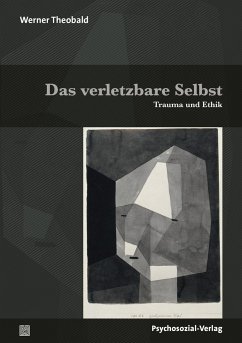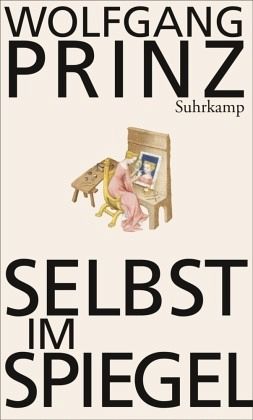
Selbst im Spiegel
Die soziale Konstruktion von Subjektivität
Übersetzung: Schröder, Jürgen
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
48,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie ist der menschliche Geist aufgebaut? Wie entsteht Subjektivität? Wie funktioniert Denken? Und was hat es mit dem ominösen freien Willen auf sich? Fragen wie diese beschäftigen seit jeher die Philosophie, aber auch die Psychologie. Wolfgang Prinz, einer der herausragenden Vertreter dieses Fachs, legt nun mit »Selbst im Spiegel« eine Theorie des Geistes vor, die den traditionellen kognitionspsychologischen Rahmen maßgeblich erweitert und zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Philosophie, zu den Neurowissenschaften und zu den Sozialwissenschaften bietet.Kraftzentrum des Buches ist die These...
Wie ist der menschliche Geist aufgebaut? Wie entsteht Subjektivität? Wie funktioniert Denken? Und was hat es mit dem ominösen freien Willen auf sich? Fragen wie diese beschäftigen seit jeher die Philosophie, aber auch die Psychologie. Wolfgang Prinz, einer der herausragenden Vertreter dieses Fachs, legt nun mit »Selbst im Spiegel« eine Theorie des Geistes vor, die den traditionellen kognitionspsychologischen Rahmen maßgeblich erweitert und zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Philosophie, zu den Neurowissenschaften und zu den Sozialwissenschaften bietet.Kraftzentrum des Buches ist die These, dass der individuelle menschliche Geist ein radikal offenes System ist, das keineswegs »fertig« auf die Welt kommt. Seine Architektur und seine zentralen Funktionen müssen erst geschaffen und geformt werden - und zwar von ihm selbst in Interaktion mit anderen geistbegabten Wesen. Prinz zeigt, wie angeborene Repräsentationsmechanismen und soziale Praktiken - Spiegelsysteme und Spiegelspiele - zusammen ein mächtiges Instrument bilden: zur Abstimmung einzelner geistbegabter Wesen aufeinander, aber auch zur Gestaltung des eigenen Geistes nach dem Vorbild anderer.Erst im Spiegel der anderen sehen und verstehen wir, was Denken und Handeln ist. Erst nachdem wir Subjektivität bei anderen entdeckt haben, schreiben wir sie uns selbst zu. Sie ist ein soziales Artefakt - ebenso wie der freie Wille und andere Überzeugungen über den menschlichen Geist. Dass sie gleichwohl keine Illusionen sind, sondern ebenso real wie Naturtatsachen, ist eine der Pointen dieser bahnbrechenden Untersuchung.