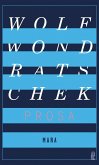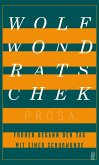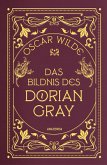"Wolf Wondratscheks Erzählen ist Seelenarchäologie." Michael Kohtes, DIE ZEIT
"Früher begann der Tag mit einer Schusswunde" - mit dieser Sammlung kurzer Prosatexte schrieb Wolf Wondratschek sich in den Status eines Kultautors. Als radikaler, liebender, experimenteller Bohemien verfasste er Verse von lakonischer Eleganz. Sein neuer Roman "Selbstbild mit russischem Klavier" ist eine glühende Hommage an die Musik und die Freiheit der Kunst.
In einem Wiener Kaffeehaus lernt ein Schriftsteller den alten Russen Suvorin kennen. Suvorin war ein erfolgreicher Pianist, doch das ist lange her. Nun steht er am Ende seines Lebens, will seine Geschichte erzählen. Gebannt hört ihm der Schriftsteller zu, denn in Suvorins Schicksal spiegeln sich ein Wille, eine Energie, die ihm vertraut sind. Und immer geht es ums Ganze: um Freiheit und Rebellion, Schönheit und Verfall, um das von der Kunst geschaffene Unvergängliche. Schon bald bekommt die Begegnung der beiden Männer, die zunächst rein zufällig anmutet, etwas Schicksalhaftes. Ein Roman voll schweifender Sehnsucht, Romantik und echtem Leben aus der Feder eines der großen deutschsprachigen Gegenwartsautoren.
"Früher begann der Tag mit einer Schusswunde" - mit dieser Sammlung kurzer Prosatexte schrieb Wolf Wondratschek sich in den Status eines Kultautors. Als radikaler, liebender, experimenteller Bohemien verfasste er Verse von lakonischer Eleganz. Sein neuer Roman "Selbstbild mit russischem Klavier" ist eine glühende Hommage an die Musik und die Freiheit der Kunst.
In einem Wiener Kaffeehaus lernt ein Schriftsteller den alten Russen Suvorin kennen. Suvorin war ein erfolgreicher Pianist, doch das ist lange her. Nun steht er am Ende seines Lebens, will seine Geschichte erzählen. Gebannt hört ihm der Schriftsteller zu, denn in Suvorins Schicksal spiegeln sich ein Wille, eine Energie, die ihm vertraut sind. Und immer geht es ums Ganze: um Freiheit und Rebellion, Schönheit und Verfall, um das von der Kunst geschaffene Unvergängliche. Schon bald bekommt die Begegnung der beiden Männer, die zunächst rein zufällig anmutet, etwas Schicksalhaftes. Ein Roman voll schweifender Sehnsucht, Romantik und echtem Leben aus der Feder eines der großen deutschsprachigen Gegenwartsautoren.

© BÜCHERmagazin, Christiane von Korff

Erst recht unter Pianisten nicht: "Selbstbild mit russischem Klavier", der neue Roman von Wolf Wondratschek, bietet viel mehr als nur eine Eigenbespiegelung des Autors.
Nun ist es heraus: "Es gibt nirgendwo so viele Dummköpfe wie unter Liebhabern der Musik. Ein Milieu, das einem zusetzen kann. Sie denken nur halbe Sachen." Wolf Wondratschek, der es ausplaudert in seinem neuen Roman "Selbstbild mit russischem Klavier", denkt wohl gewiss lieber ganze Sachen, schreibt aber, wie hier, zuweilen nur halbe auf, zu denen sich dann der Leser - wie es schon Johannes Brahms von seinen eigenen Briefen behauptete - die andere Hälfte dazudenken muss. Denn wer hier was denkt, sagt oder ergänzt, Wolf Wondratschek, der Pianist Juri Suvorin (halbwegs frei erfunden) oder der Cellist Heinrich Schiff (den gab es wirklich), das muss der Leser sowieso selbst herausfinden. Wenn er es denn schafft. Einfach ist das nicht, aber, das sei gleich dazugesagt, auch nicht anstrengend und schon gar nicht entscheidend. Wenn man einmal mitgerissen wurde und einen die Sympathie mit diesem erfahrungssatten, äußerst liebenswürdigen Buch erfasst hat, spielt das ohnehin keine Rolle mehr.
Von der ersten Seite des Romans an geraten nämlich Subjekt und Objekt des Erzählens ins Flimmern. Ein namenloses Ich trifft in einem Wiener Kaffeehaus unserer Tage den russischen Pianisten Juri Suvorin. Wer da aber über wen redet in den resignierten Satzfetzen, die durch den Fluss der Sprache treiben wie das Interieur eines unterspülten, eingestürzten Hauses, ob ich über ihn spricht oder er über sich als ich mit ihm, also dem Ich, das ihn im Kaffeehaus trifft, das ist in den Strudeln der Perspektivwechsel bald nicht mehr auszumachen.
Der Titel "Selbstbild mit russischem Klavier" legt nahe, dass Wondratschek in einem autofiktionalen Spiel auch über sich selbst schreibt. Am 14. August wurde er 75 Jahre alt. Über Suvorin erfahren wir, er sei beim Tod der rumänischen Pianistin Clara Haskil - also 1960 - fünfzehn Jahre alt gewesen, also Jahrgang 1945. Doch wenn schon auf der dritten Seite die Erinnerungen an das Idyll einer Kindheit in Russland enden mit dem Satz "Dann kamen die Deutschen", wird das Verhältnis von Figur und Geschichte so unscharf wie die Welt vor den Augen eines Kurzsichtigen, der die Brille absetzt.
Schlampigkeit des Schreibens ist das nicht, sondern Absicht, denn das Gleiten der Zeit in den Erzählungen des Alters wird hier ausdrücklich zum Thema: "So war das mit Suvorin. Mit ganz wenigen, sehr langsam gesprochenen Sätzen macht er Kinder erwachsen, aus einem Jungen wird ein Mann, aus dem Mädchen eine Frau, aus beiden etwas, das alle üblichen Mängel einer Liebesgeschichte aufweist."
Suvorin, der bei einem Verkehrsunfall erst kürzlich seine Frau verlor und dem nun langsam die Kontrolle über seine Wohnung wie über sein Leben entgleitet, wird als Russe vorgestellt mit allen Klischees, die man im Westen mit Russen so in Verbindung bringt: ihre Nähe zum Alkohol, ihr Heimweh im Ausland, ihre übergroße Liebe zur Musik. Aber Wondratschek, das merkt man bald, verfügt über Innenansichten des Milieus, die ihn vor Sentimentalität und Exhibitionismus lebensklug zurückschrecken lassen. Mit ebenso diskreter wie abgeschrammter Ironie schildert er sogar, wie sich ein russischer Komponist das Vorurteil einer reichen Deutschen, "Russen seien im Bett zu allem fähig", zunutze zu machen weiß.
Es sind zwei Männer gleichen Alters, die sich hier darüber unterhalten, dass früher alles besser war: gefährlicher, intensiver, vitaler, die Frauen schöner, die Kämpfe lohnender. Auch das kennt man von Wondratschek. "Früher begann der Tag mit einem KGB-Verhör" ließe sich allzu leicht über die Erzählungen Suvorins setzen, wenn er sich der Zumutungen des sowjetischen Geheimdienstes entsinnt. Und mit dem Verfasser des Romans, der sich dem Literaturbetrieb bereits soweit entzog, dass er das Manuskript zu "Selbstbildnis mit Ratte" exklusiv an den Investor Helmut Meier verkauft hat, teilt sein Geschöpf Suvorin die Lust an der Verweigerung. Der Pianist nämlich hörte auf, klassische Musik im Konzert zu spielen, weil er Applaus nicht leiden konnte.
Doch es sind auch die Zumutungen des Alters, denen sich Wondratschek hier stellt: der Verfall der Gesundheit und mit ihr jener der Würde, die Angst vor dem Mitleid und die Versuchung, diesen Verfall selbst abzukürzen. Dann ist es wieder die Sprache, die sich aus dem Andrang des Biologischen heraus in die Anmut des Spiels erhebt bei der Schilderung ärztlich verbotenen Kaffeegenusses: "Mein Herz liebt meine Dummheiten. Nicht alle, aber diese eine und ein paar andere, und verzeiht sie mir, wie ich hoffe. Noch immer schlägt es, ohne auszusetzen, seinen Takt." Hier wird die Syntax semantisch, denn die Parenthese "ohne auszusetzen" unterbricht mit einem Augenzwinkern die weitgehend parataktische Fügung der Sätze ausgerechnet dort, wo es um den Rhythmus eines kranken Herzens geht. Elliptisch wird dabei der Begriff umgangen, in welchem Musiktheorie und Kardiologie hätten zusammenfinden können: die Synkope.
Wondratscheks Verhältnis zur Musik ist eng, so eng, dass er - wie Brahms auch - kein Geschwätz darüber ertragen kann. Besonders den Cellisten Heinrich Schiff, der nach langer Krankheit am 23. Dezember 2016 starb, hat er gut gekannt, dessen Stradivari-Cello mit dem Buch "Mara" bereits 2003 ein Stück Literatur gewidmet. Schiff tritt gegen Ende dieses "Selbstbildes" eindrucksvoll auf: barock, ungeschlacht, gierig nach Leben, mit Krankheit geschlagen. Und in einer Konversation, die Schiff schweigend belächelt, äußert Suvorin seine Vermutungen, warum Beethoven, der das Cello liebte, kein Konzert für dieses Instrument geschrieben hat: "Aus Schüchternheit? Das habe ich mich oft gefragt. War Beethoven schüchtern? Keiner hängt, was er liebt, an die große Glocke. Beethoven, der sich als Komponist verausgabte, sich aber nicht hingibt. Wahre Liebe war Verzicht. Also kam so etwas Monumentales wie ein Cellokonzert nicht in Frage."
Die Antwort ist vermutlich viel pragmatischer, als so ein Liebhaber der Musik sich das denkt: Beethoven wird keinen passenden Solisten gehabt haben. Doch mag es auch nur halb gedacht sein, so ist es doch sehr schön gesagt. So schön wie das Porträt der Pianistin Elisabeth Leonskaja, das Wondratschek am Ende zeichnet: "Was für eine stattliche, beeindruckende Erscheinung sie noch immer ist, das steht fest, über welche Energie sie noch immer verfügt, wenn sie auftritt, nicht der geringste Verschleiß, und dann, das hatte ihm vor vierzig Jahren in Moskau schon gefallen, ihre Mähne, die sie bis heute hat und die sie so attraktiv erscheinen lässt. Sie scheint es nicht eilig zu haben, dem jungen Gemüse das Podium zu überlassen, und das ohne jeden unangebrachten Ehrgeiz. Sollen sie ihre Schönheitswettbewerbe unter sich ausmachen. Sie kämpft nicht, sie lässt, was sie tut, geschehen." Wer je das Glück hatte, Elisabeth Leonskaja zu hören, sie zu sehen, sie zu sprechen, ihre Hand zu halten, der weiß: Was Wondratschek schreibt, ist alles wahr.
JAN BRACHMANN
Wolf Wondratschek: "Selbstbild mit russischem Klavier". Roman.
Ullstein Verlag, Berlin 2018. 271 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main