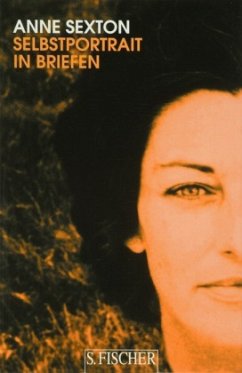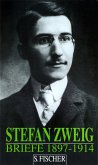Ihre Lyrik verstand Anne Sexton ausdrücklich als Umformung ihres intensiven Lebens. Der Reiz ihrer Briefe liegt nun darin, daß hier auf ebenso leidenschaftliche wie selbstkritische Weise die Ereignisse geschildert werden, die dieses lyrische Selbst prägten. Da Anne Sexton nicht nur Zeit ihres Lebens die eigene Todessehnsucht zum Thema ihrer Lyrik machte, sondern ihr Selbstmord für ihre Nachwelt immer ein Rätsel bleiben muß, ist man geneigt, in diesen Briefen eine Antwort auf diese Todessucht zu suchen. Tatsächlich wird in diesen Briefen auf ungewöhnlich offene Weise die Verzweiflung und Verlassenheit geschildert, mit der Anne Sexton auf die vielen Tode in ihrer Familie reagiert, so wie sie rückhaltlos Aufzeichnungen der eigenen Delirien, Halluzinationen und Angstvorstellungen an ihre Freunde schickt.
Doch die Briefe dokumentieren auch den mannigfaltigen Ausdruck der Liebe für ihre Mitmenschen: die Zärtlichkeit für ihre Töchter, das Eingeständnis der Abhängigkeit von ihrem Ehemann, die grenzenlose Forderung nach Anerkennung und Zuwendung, die sie an ihre Liebhaber stellt. Zugleich zeigen sie Sextons Professionalität: die Entschlossenheit, ihre Gedichte auf dem literarischen Markt durchzusetzen, Eifersucht auf die Erfolge anderer, aber auch die Ehrfurcht, die sie für andere Autoren empfindet. Es entsteht das Portrait einer widersprüchlichen Frau, die ebenso von den Dämonen des eigenen Wahnsinns und den Phantomen ihrer Verstorbenen getrieben ist wie von einer unerbittlichen und überschwenglichen Bejahung des Lebens.
Doch die Briefe dokumentieren auch den mannigfaltigen Ausdruck der Liebe für ihre Mitmenschen: die Zärtlichkeit für ihre Töchter, das Eingeständnis der Abhängigkeit von ihrem Ehemann, die grenzenlose Forderung nach Anerkennung und Zuwendung, die sie an ihre Liebhaber stellt. Zugleich zeigen sie Sextons Professionalität: die Entschlossenheit, ihre Gedichte auf dem literarischen Markt durchzusetzen, Eifersucht auf die Erfolge anderer, aber auch die Ehrfurcht, die sie für andere Autoren empfindet. Es entsteht das Portrait einer widersprüchlichen Frau, die ebenso von den Dämonen des eigenen Wahnsinns und den Phantomen ihrer Verstorbenen getrieben ist wie von einer unerbittlichen und überschwenglichen Bejahung des Lebens.

Der Weg zum Selbstmord: Die Lyrikerin Anne Sexton in ihren Briefen · Von Harald Hartung
Am Anfang dieses "Selbstportraits in Briefen" haben wir eine neunzehnjährige junge Frau, die mit ihrem Freund durchbrennt und heiratet. "Wenn Ihr das lest, habt Ihr bereits einen neuen Schwiegersohn", schreibt sie im August 1948 an ihre Eltern. Der letzte Brief, den wir in dieser Auswahl lesen, stammt vom 31. Juli 1974 und ist an Erica Jong gerichtet. Die Schreiberin, die sich das Jahr zuvor von ihrem Mann getrennt hat, nennt die Männer "Hasenfüße" und endet mit den Worten: "Paß auf Dich auf, meine Liebe - liebe, liebe Freundin." Aber das klingt wie eine letzte Mahnung an die eigene Adresse. Am 4.Oktober begeht die Lyrikerin Anne Sexton, knapp sechsundvierzigjährig, Selbstmord - oder soll man sagen, gelingt ihr der letzte ihrer Suizidversuche.
Er gelang ihr, weil sie, wie ihre Tochter später schrieb, "zu ihrem Tod" nach Haus zurückgekehrt war - ohne Ankündigung oder Warnung, zudem in einer Phase der psychischen Erholung. Tags zuvor hatte sie in Maryland gelesen, und mit einer Vertrauten war sie noch die Druckfahnen eines Gedichtbandes durchgegangen. "Mich retten nur Gedichte", hatte Anne Sexton einmal zu Anfang ihrer Karriere geschrieben und später immer wieder dieses Rettungsmittel beschworen.
"Selbstmord ist schließlich das Gegenteil des Gedichts", schreibt sie 1965 an den Herausgeber einer Zeitschrift, der dabei ist, eine Nummer über Sylvia Plath zusammenzustellen. In diesem Brief kommt Anne Sexton auf ihre Bekanntschaft mit Sylvia zu sprechen. Sie hatten einander in Robert Lowells Lyrik-Seminar an der Boston University kennengelernt. Nach dem Seminar gingen sie gelegentlich ins Ritz, um bei Martinis und kostenlosen Kartoffelchips "detailliert, eingehend" über ihre Suizidversuche zu sprechen: "Wir waren einfach zwei Barhockerinnen - die vom Tod redeten - nicht vom Schöpferischen."
Das Gedicht stand dabei nicht zur Debatte. Jede der beiden "Barhockerinnen" hatte ihre eigene Variante im Kopf, jede ihren enormen Ehrgeiz, "es zu schaffen - eine große Dichterin zu sein". Beide schafften es. Man weiß, um welchen Preis. Von der Elegie, die Anne Sexton später auf den Tod ihrer Kollegin schrieb, heißt es in einem Brief an Ted Hughes: "Mein Gedicht verleitet zu der Annahme, daß ich sie gut kannte, während ich doch nur ihren Tod gut kannte."
Das ist sicher wahr, meint aber auch eine sehr deutliche Einschränkung. Anne Sexton mochte nicht verglichen werden. Vielleicht weil sie wußte, daß der Tod den Vergleich eines Tages nahelegen könnte. Zumal auch das Leben Motive für Vergleichungen lieferte. Daher ist ihre erkennbare, wenn auch untergründige Rivalität mit Sylvia Plath ein interessantes Moment der Briefe. Gerade deshalb liest man sie auch als Korrektur, als Zeugnis der Unverwechselbarkeit von Sextons Leben und Werk. Das mag die Aufnahme der Briefe in eine Werkausgabe rechtfertigen.
Dennoch sind die Briefe nicht mit Blick auf literarische Verwertung oder auf die Nachwelt geschrieben. Nicht einmal mit Blick auf Orthographie, mit der Anne Sexton zeitlebens auf Kriegsfuß stand, ohne schlechtes Gewissen übrigens: "Wir sind auch ins Colluseum (Rechtschr.?) gegangen, in dem abends hier und da blaue Lichter an waren." Wir lesen tatsächlich private Briefe. Selbststilisierungen, mit denen die Autorin manchmal kokettiert, werden durch Ironie relativiert. Nie redet sie hinter vorgehaltener Hand. Nie haben wir das Gefühl, die Schreiberin sei indiskret. Sie kann uns nerven, doch sie erscheint stets rückhaltlos aufrichtig. Selbst den Geschäftsbriefen an Redakteure oder Jurymitglieder fehlt alle Diplomatie. Vielleicht war es das, was ihr die Türen öffnete?
Was immer und bis in die letzten Briefe frappiert, ist Anne Sextons spontane, gleichsam natürliche Intelligenz, ihre unverstellte Fähigkeit zur Analyse. Auch zur Analyse dessen, was zum Gesetz ihres Lebens und Sterbens wurde. Mehrfach kommt sie auf ihre Initiation zu sprechen, die sie aus Klischee und Lebenskonvention in die Erfahrung des Schmerzes und der Poesie führte.
Nach dem Abitur hatte Anne Sexton eine Schule besucht, auf der höhere Töchter für die Ehe vorbereitet wurden. Diese Ehe aber setzt einen desaströsen Prozeß in Gang. Die junge Ehefrau, die sich durch Geburt und Aufzucht ihrer beiden Kinder überfordert fühlt, macht eine Reihe von Selbstmordversuchen und muß längere Zeit in Kliniken verbringen. Im Lauf einer psychiatrischen Behandlung ermutigt sie ihr "Dr. Martin", Lyrik zu schreiben. Genauer: wieder Lyrik zu schreiben. Denn Anne Sexton hatte die Poesie aufgegeben, nachdem die Mutter, die selbst dichtete, ihr vorgeworfen hatte, ihre Gedichte seien Plagiate. Ein knappes Jahr später - Oktober 1957 - wird ihr erstes Gedicht zur Publikation angenommen. 1960 erscheint ihr erster Gedichtband, der ihre Klinikerlebnisse verarbeitet, und wird für den National Book Award nominiert. Ein Wunder? Ein problematisches, wie sich zeigen sollte.
Anne Sexton bringt es selbstironisch auf den Punkt. An eine Freundin schreibt sie: "Ich war eine dumme Pute, die nichts besaß außer einem Kabriolett und die nie etwas gelernt hat, nicht einmal Rechtschreibung. Ich fing erst mit 28 an, erwachsen zu werden." Was dann aber folgt, das wollte die Dichterin nicht so eindeutig fixiert sehen. Eines der interessantesten Zeugnisse ist ein Brief an den Dichter und Kritiker John Stallworthy, den Lektor ihres britischen Verlages. Ihm, der offenbar nach einer selbstbiographischen Notiz gefragt hatte, bot sie einige Angaben und Deutungen, mit dem Ansinnen, die gewünschte "aufs Äußere reduzierte Biographie" zu verfassen: "Verstecken Sie mich. Nicht notwendigerweise vor den ,Fans', sondern vor mir selbst." Anne wußte genau, was sie am Abfassen der gewünschten Äußerung hinderte: "Steht das nicht alles irgendwo in den Gedichten? Steht nicht sogar zuviel davon in den Gedichten, eine schamlose Zurschaustellung und Auflistung der eigenen LEBENSGESCHICHTE?"
Das ist das offene Geheimnis dessen, was man schulmäßig "Confessional Poetry" nennt und wofür Anne Sexton, Sylvia Plath und ihr gemeinsamer Lehrer Robert Lowell als Protagonisten figurieren. Anne Sexton hat ihren Part mit mindestens dem gleichen Furor absolviert wie ihre Kollegen. Auch davon zeugen ihre Briefe. Angefangen bei dem Diktum, das sie gegenüber dem befreundeten Lyriker W. D. Snodgrass erwähnt: "Ich habe einmal zu Dr. Martin gesagt, daß es mir egal sei, wenn ich für immer verrückt bliebe, wenn ich nur gut schreiben könnte." Bekenntnisdichtung hat einen anderen Ehrgeiz als den, Selbsttherapie zu sein. Einmal heißt es etwas pathetisch: "Der Schmerz muß erforscht werden wie eine Seuche." Doch das am eigenen Leibe, an der eigenen Psyche zu tun, mußte auch das starke Naturell Anne Sextons auf Dauer überfordern.
Um so eher, als die Moralistin in ihr gegen das "Rettungsmittel" Lyrik zunehmend Vorbehalte entwickelte. Schon nach den ersten Erfolgen fragt sie sich mißtrauisch, ob sie ihre poetische Unschuld nicht verloren habe, und bei ihrem dritten Buch quält sie die Furcht, die besten poetischen Einfälle bereits hinter sich zu haben. Dabei betrieb Anne Sexton ihre Karriere bis zum Schluß überaus professionell und mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Sie forderte mehr als anständige Honorare, diktierte die Bedingungen bei Lesungen - bis in die Wahl der Mikrofone. Ja, sie organisierte ihre eigene Werbekampagne. Erfolg und Ruhm blieben nicht aus: der Pulitzerpreis, die Dozenturen, die Ehrendoktorate.
So schienen sich auch ihre Lebensverhältnisse zu stabilisieren; das Verhältnis zu den Töchtern, zu ihrem Mann. Selbst in ihrer Poesie will sich offenbar eine lichtere Seite zeigen. Anne Sexton schreibt "Verwandlungen", lyrische Paraphrasen auf Grimms Märchen. Aber ebendas scheinen die Fans, die Freunde, die Verlage nicht übermäßig zu goutieren. Das eingeforderte Lob erscheint ihr halbherzig. Und schließlich kommen die Jahre, in denen sich alles im Kreise dreht und selbst die Krankheit sie zu langweilen beginnt. Ein Ersatz für ihre Besuche psychiatrischer Abteilungen kommt nie in Sicht.
Im März 1973 trennt Anne Sexton sich von ihrem Mann, vermutlich im Bewußtsein ihres bevorstehenden Endes. "Ich verliere wohl in gewisser Hinsicht den Boden unter den Füßen", schreibt sie an ihren neuen englischen Lektor, "aber sag das nicht weiter, denn solange die Gedichte nicht draufgehen, ist es okay." Der Tochter Linda macht sie zum einundzwanzigsten Geburtstag ein höchst eigentümliches Geschenk: ihren literarischen Nachlaß. Das möge für ihr künftiges Einkommen wichtig sein, meint die Mutter und fährt fort: "vielleicht . . . aber nur vielleicht reicht der Geist der Gedichte ja auch über uns beide hinaus, wird man sich an das eine oder andere noch in hundert Jahren erinnern".
Die getreue Tochter ließ drei Jahre nach dem Tod der Mutter eine erste Ausgabe der Briefe erscheinen. Auf einer Neuausgabe von 1991 basiert die deutsche Version, die Silvia Morawetz präzis übersetzte und zu der Elisabeth Bronfen ein informatives Vorwort schrieb.
Anne Sexton: "Selbstportrait in Briefen". Herausgegeben und mit einem Vorwort von Elisabeth Bronfen. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Silvia Morawetz, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1997. 463 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main