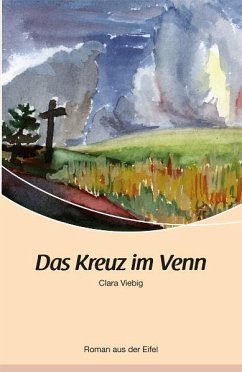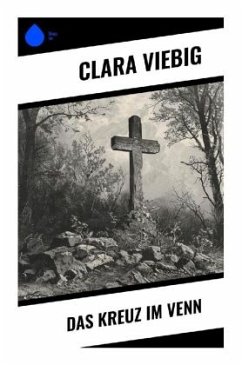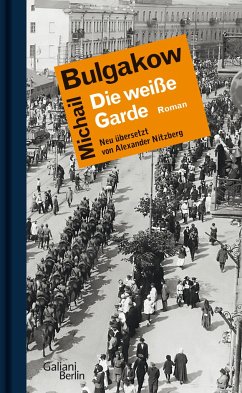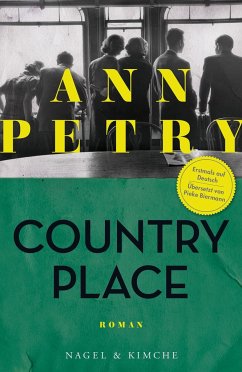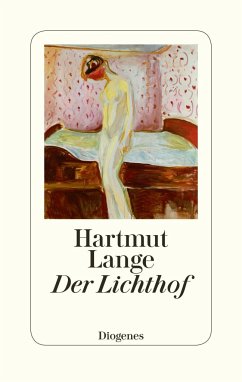Septembergewitter

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nachmittags um vier beginnt unsere Geschichte, und sie endet abends. Wie ein Kreisel zieht die Handlung am Leser vorüber. Der Großvater, der Totengräber ist, und seine Enkelinnen. Der böse Emil, der den Kindern die Drachenschnüre durchschneidet, weil er nicht will, dass sie in den Himmel fliegen. Der kleine Martin, der in die Bubenbande des starken Jan aufgenommen werden möchte, aber eben nicht so stark ist, wie es sein verstorbener Vater war. Der junge Leutnant Charisius, der beschließt, nach Kamerun zu gehen, weil man dort so schön sterben kann. Seine Geliebte, Marie, die vor einer W...
Nachmittags um vier beginnt unsere Geschichte, und sie endet abends. Wie ein Kreisel zieht die Handlung am Leser vorüber. Der Großvater, der Totengräber ist, und seine Enkelinnen. Der böse Emil, der den Kindern die Drachenschnüre durchschneidet, weil er nicht will, dass sie in den Himmel fliegen. Der kleine Martin, der in die Bubenbande des starken Jan aufgenommen werden möchte, aber eben nicht so stark ist, wie es sein verstorbener Vater war. Der junge Leutnant Charisius, der beschließt, nach Kamerun zu gehen, weil man dort so schön sterben kann. Seine Geliebte, Marie, die vor einer Woche ermordet aufgefunden wurde. Wer war der Täter? Die Buben werden ihn später aufspüren, die Überraschung ist groß ... Es kann viel passieren an einem heißen Septembertag in der kleinen Stadt. "Man muss'n bisschen lachen dabei, aber es ist doch auch traurig. Natürlich geht das Ganze schief aus." Friedo Lampes lyrische Prosa, die filmartige Erzähltechnik, mit der er seine Szenen miteinander verwebt, erweist sich in "Septembergewitter" als gelungenes Beispiel eines magischen Realismus, dem Sachlichkeit und Wunder nicht als Gegensätze gelten.