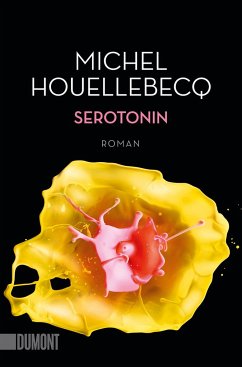Als der 46-jährige Protagonist von 'Serotonin', dem neuen Roman des Goncourt-Preisträgers Michel Houellebecq, Bilanz zieht, beschließt er, sich aus seinem Leben zu verabschieden - eine Entscheidung, an der auch das revolutionäre neue Antidepressivum Captorix nichts zu ändern vermag, das ihn in erster Linie seine Libido kostet. Alles löst er auf: Beziehung, Arbeitsverhältnis, Wohnung. Wann hat diese Gegenwart begonnen? In der Erinnerung an die Frauen seines Lebens und im Zusammentreffen mit einem alten Studienfreund, der als Landwirt in einem globalisierten Frankreich ums Überleben kämpft, erkennt er, wann und wo er sich selbst und andere verraten hat.Noch nie hat Michel Houellebecq so ernsthaft und voller Emotion über die Liebe geschrieben. Zugleich schildert er in 'Serotonin' den Kampf und den drohenden Untergang eines klassischen Wirtschaftszweigs in unserer Zeit der Weltmärkte und der gesichtslosen EU-Bürokratie.»Ein Roman, der mehr als Symptom unserer Zeit zu lesen ist denn als Analyse unserer Gegenwart.« ORF BESTENLISTE
»Tritt ein, lieber Leser, in die Düsternis des Abendlandes, und beginne die Reise ans Ende der Nacht.« Romain Leick, DER SPIEGEL »Ein tieftrauriges Buch über die Liebe.« Mathias Wert, ARD Tagesthemen »Die Sprache, das darf man nicht vergessen, ist das eigentlich Ereignis bei Michel Houellebecq.« Julia Encke, FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG »Wo zum Teufel findet man denn intelligentere Gegenwartsdiagnosen von schmerzhafterer Klarheit und zwingenderer Radikalität als bei Houellebecq?« Denis Scheck, ARD DRUCKFRISCH »Ich hab selten zuvor ein Buch gelesen, in dem so eine Dunkelheit herrschte, so eine Verzweiflung und Einsamkeit und ich trotzdem auf jeder Seite schallend lachen musste« Volker Weidermann, DAS LITERARISCHE QUARTETT »Warum begeistert mich dieser Autor? Ganz einfach: Weil ich keine intelligenteren Zeitdiagnosen unserer Gesellschaft finde in der Gegenwartsliteratur als bei Michel Houellebecq.« Denis Scheck, SWR LESENSWERT QUARTETT »Sprachlich bewegt sich [das Buch] auf einer sehr großen Klaviatur« Nicola Steiner, SRF LITERATURCLUB »Ein tieftrauriger Liebesroman« Jan Wiele, FRANKFUTER ALLGEMEINE ZEITUNG »Ein tiefes, schönes Buch über die menschliche Existenz. [...] [Houellebecq] ist ein großer Künstler.« Mara Delius, DIE LITERARISCHE WELT »Wow, eine so kluge Gegenwartsanalyse habe ich lange nicht mehr gelesen, dieses Buch macht einen klüger« Denis Scheck, WDR2 LESEN »Große Erzählkunst, wenn die Beklemmung, die Scham, die Unfähigkeit zu spüren ist [...]. Umwerfend erzählt.« Doris Akrap, TAZ »Ein Roman, der mehr als Symptom unserer Zeit zu lesen ist denn als Analyse unserer Gegenwart.« ORF Bestenliste »'Serotonin' ist ein zynischer Abgesang auf das Leben westlicher Prägung. Zugleich eine vertrackte Liebeserklärung an eben dieses.« Katja Gasser, ORF ZIB1 »Literarisch sehr geschickt gemacht [...]. Die Sprache fängt an zu sprühen [...]. Und da Entsteht eine Spannung, die sehr verstörend ist.« Christine Lötscher, 3SAT KULTURZEIT »Houellebecq ist ein grosser Theoretiker der Liebe - er versteht sich meisterhaft darauf, Männer zu beschreiben, die ihrer vollkommen unfähig sind.« Tobias Sedlmaier, NZZ am Sonntag »Horror-Satire über das Ende der Welt« Iris Radisch, DIE ZEIT »[Man] kann Serotonin auch als Hymne an die romantische Liebe lesen.« Sabine Glaubitz, DPA »Am Ende bleibt von der vielbeschworenen Freiheit des Westens nicht mehr übrig als 'eine kleine, weiße, ovale, teilbare Tablette'.« Mathias Dusini, FALTER »Houellebecq [zeigt], was er kann, Krimi, Groteske, Liebesroman, Sozialreportage, alles wird angespielt und zitiert.« Alex Rühle, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG »Und vielleicht gehört es darum zum Besten seiner quecksilbrigen Literatur, dass für sie gilt: Was immer man über sie sagt, das Gegenteil trifft genauso zu.« Roman Bucheli, NEUE ZÜRCHER ZEITUNG »Es ist ein Buch, das einen neuen Houellebecq zeigt, einen, der an die Möglichkeit des Glücks zumindest glaubt.« Stefan Gmünder, DER STANDARD »Dieser außergewöhnliche Stil, der zwischen schreiender Komik und abgrundtiefer Melancholie wechselt, macht auch dieses Buch zu einem 'echten Houellebecq'.« Dirk Fuhrig, DLF Kultur »Ein unglaublich guter Autor« Jörg Magenau, RBB KULTUR »Er ist in der Tat literarisch herausragend.« Andreas Isenschmid, DLF KULTUR »Sprachlich auf der Höhe seiner Kunst.« Dirk Fuhrig, WDR 3 Mosaik »Umwerfend ist Michel Houellebecq aber zweifellos immer dann, wenn ihn nicht der visionäre (und manchmal auch moralische) Furor packt und er sich auf thematischen Nebenschauplätzen bewegt.« Jochen Kürten, DEUTSCHE WELLE »Serotonin ist Houellebecqs womöglich bester Roman. [Er ist] alles andere als trübsinnig. Ja, zuweilen ist die Lektüre ein schwarzer, sarkastischer Spaß.« Martin Oehlen, KÖLNER STADT-ANZEIGER »Wir haben gelacht und uns entsetzt. Aber in dem Moment, in dem Michel Houellebecq uns mit unserem lustvollen Kummer allein lässt, wir dem schauerlich-schönen Klagegesang des Erzählers entkommen sind, fassen wir eigene Gedanken.« Alexander Solloch, NDR Kultur »Am Ende dieses urkomischen und zugleich tieftraurigen Romans hält Houellebecq ein regelrechtes Plädoyer für die Liebe, die in der heutigen Zeit durch die Illusion von individueller Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten zum Scheitern verurteilt ist.« Welf Grombacher, MÄRKISCHE ODERZEITUNG »[Houellebecq ist] ein glänzender Autor und ein gnadenloser Chronist unserer Zeit. Es gibt nicht viele von seiner analytischen Schärfe und seiner Rücksichtslosigkeit.« Bettina Schulte, BADISCHE ZEITUNG »Sich über Houellebecq und 'Serotonin' wundern: ja. Sich ärgern: unbedingt! Aber lesen.« Peter Pisa, KURIER »Houellebecq hat sich neu erfunden.« Felix Schneider, SRF2 Kultur »Kann ich nicht einfach so lesen, muss man zelebrieren.« Harald Schmidt »'Serotonin' ist Houellebeqcs bisher persönlichstes Buch. Aus einem Guss. Ein Wurf.« Peter Burri, BASLER ZEITUNG »Wer keine Fragen ans Leben richten will, sollte besser die Finger von diesem Roman lassen. Alle andere greifen bitte zu.« Lothar Schröder, RHEINISCHE POST »Seine Traurigkeit ist unser aller Traurigkeit.« Knut Cordsen, BR »Der Provokateur Houellebecq [zeigt] sich von seiner einfühlsamen, zarten und verletzlichen Seite. Von einer Intensität, die tieftraurig macht - und dieses Buch so besonders.« Franziska Trost, KRONEN ZEITUNG »Sein Roman ist ein Meisterwerk, der Schmutz in große Literatur wandelt.« Susanne Zobl, NEWS »'Serotonin' steht als Prosakraftakt ganz für sich selbst, vielleicht wie noch kein Houellebecq-Roman zuvor.« Wolfgang Paterno, PROFIL »Eine klare Leseempfehlung« Thomas Andre, HAMBURGER ABENDBLATT »Es geht um die größte Gefahr unserer Gesellschaft: Einsamkeit - und die einzige Rettung: Liebe.« Marie Kaiser, RBB radioeins »Ein dreiviertel Jahrhundert nach Albert Camus erschafft Michel Houellebecq in 'Serotonin' einen neuen Fremden.« Tilla Fuchs, SR 2 KulturRadio »eine großartige stilistische Neuerfindung« Katharina Hirschmann, Manuel Chemineau, WIENER ZEITUNG »Der ideale Schriftsteller des postideologischen Zeitalters« Anton Thuswaldner, DIE FURCHE

Noch nie klang Michel Houellebecq so düster wie in seinem neuen Roman "Serotonin": Sex ist Perversion und Verbrechen, Liebe höchstens eine Möglichkeit. Helfen nur Drogen?
Da lag der neue Roman von Michel Houellebecq also auf dem Tisch: "Serotonin" stand auf dem schwarzen Cover, auf dem knallgelbe und rosa Farbe zu explodieren schien. Oder war es eine Aufnahme aus einem biologischen Labor? Ich beobachtete mich dabei, wie ich alles Mögliche tat, um nicht mit dem Lesen beginnen zu müssen. Grund dafür war eine Mischung aus Angst und Freude. Ich freute mich schon die ganze Zeit auf dieses Buch, das in Frankreich, wo es ein paar Tage früher erschienen ist, in den Zeitschriften und Zeitungen überall gefeiert wird. Gleichzeitig hatte Houellebecq, in typischer Houellebecq-Manier, kurz vor Erscheinen wieder den Provokateur gegeben, in einer Weise, der nichts mehr abzugewinnen war außer Abscheu und Verzweiflung.
Dass er sich überhaupt wieder an die Öffentlichkeit gewandt hatte, überraschte bezeichnenderweise niemanden. Dabei war es noch gar nicht lange her, dass der Schriftsteller, nachdem er bei der Buchmesse in Frankfurt im Oktober 2017 aufgetreten war, dem "Spiegel" anvertraut hatte, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. "Ich bin mir bewusst, dass ich das, was ich wirklich gern sagen möchte, nicht wirklich ausdrücken kann", hatte er gesagt - was am Ende des besonders langen Gesprächs ziemlich ironisch klang. Den "Spiegel" hatte das nicht davon abgehalten, den Schriftzug "Das letzte Interview" aufs Cover zu drucken.
Dann war passiert, womit alle gerechnet hatten: Michel Houellebecq war wieder da - oder in Wirklichkeit nie weg gewesen. Er trat in Georgien in einem Theater und bei einer Diskussionsveranstaltung auf. Er heiratete im September seine Freundin Lysis, was Carla Bruni-Sarkozy, die eingeladen war, als kalkulierte Indiskretion auf Instagram für die Weltöffentlichkeit postete. Und weil all das nach Houellebecq-Maßstäben vielleicht ein wenig zu schön und zu rührend war, veröffentlichte er nur ein paar Wochen vor Erscheinen des neuen Romans im New Yorker "Harper's Magazine" einen Beitrag unter dem Titel "Trump Is a Good President", in welchem er den amerikanischen Präsidenten zwar einen "beängstigenden Clown" nannte, ihn aber wegen seiner protektionistischen Handelspolitik, seiner Verachtung für die EU und den harten Umgang mit Staatschefs wie Wladimir Putin und Kim Jong-un uneingeschränkt lobte.
Houellebecqs Literaturagentur Intertalent verbreitete am gleichen Tag dann auch noch Fotos von den Dreharbeiten des Filmregisseurs Guillaume Nicloux, die die Schauspieler und Autokratenverehrer Gérard Depardieu und Michel Houellebecq in weißen Bademänteln im Hotel "Thalasso Cabourg Plage" zeigten. Das war wirklich zu viel. Aber - den Autor konnte es nur freuen - alle redeten darüber. Und ich bekam Angst davor, was der Roman "Serotonin" alles Unangenehmes enthalten und offenbaren könnte.
Dass beim Lesen diese Angst sofort aufhört, ist ein Effekt, der etwas mit Houellebecqs Sprache zu tun hat. Diese Sprache hervorzuheben, ist wahrscheinlich noch wichtiger, als die Frage zu beantworten, ob Houellebecq auch diesmal wieder eines der gesellschaftspolitischen Themen der Gegenwart verhandelt - wie die Gentechnik in "Elementarteilchen", den Terrorismus in "Plattform" oder den Islam in "Unterwerfung". (Tut er natürlich, aber dazu gleich.) Er versuche, keinen Stil zu haben, hat Houellebecq einmal erklärt, was ein Paradox ist: Die angestrebte Abwesenheit von Stil, der Nichtstil, ist selbst ein Stilphänomen, nämlich das des "unprivilegierten Blicks", wie Rainald Goetz das genannt hat: "Weil Houellebecq auf die Beiläufigkeit und Alltäglichkeit seiner Sprache genauso viel Wert legt wie auf die mittlere Durchschnittlichkeit seiner Helden", so Goetz, "entsteht ein zugleich traditioneller und hochmoderner Realo-Stil des Erzählens." Und der trägt einen von der ersten bis zur letzten Seite auch durch das neue Buch. Die Sprache, das darf man nicht vergessen, ist das eigentliche Ereignis bei Michel Houellebecq.
Um einen ganz und gar durchschnittlichen Helden geht es auch in "Serotonin". Von ihm wird im Rückblick auf die Gegenwart aus der Zukunft heraus erzählt, als eine Erinnerung an die Zeit, in der Emmanuel Macron Staatspräsident war. Florent-Claude Labrouste heißt der neue Durchschnittsheld. Er ist sechsundvierzig Jahre alt, Agraringenieur und Angestellter im Landwirtschaftsministerium. Er hasst seinen Vornamen. Man sieht sich schon in Houellebecqs ersten Roman "Ausweitung der Kampfzone" zurückversetzt. Überhaupt hat man zunächst den Eindruck, sich auf einer Art "Farewell"- oder "Still not dead yet"-Tour zu befinden, bei der der Autor seine Lieblingsthemen und -motive alle noch einmal zusammenführt.
Nur gibt es da einen wesentlichen Unterschied zu allen vergangenen Helden. Florent-Claude Labrouste leidet unter schweren Depressionen und nimmt Medikamente: "Die ersten bekannten Antidepressiva (Seroplex, Prozac) erhöhten den Serotoninspiegel im Blut, indem sie die Serotoninwiederaufnahme durch die 5-HT1-Rezeptoren hemmten", heißt es auf Seite 9. "Die Entdeckung von Capton D-L im Jahr 2017 ebnete einer neuen Generation von Antidepressiva mit einer letztlich einfacheren Verfahrensweise den Weg, bei der es darum geht, mittels Exozytose die Freisetzung des in der Magenschleimhaut gebildeten Serotonins zu befördern. Seit Ende des Jahres wird Capton D-L unter dem Produktnamen Captorix vermarktet. Es erwies sich auf Anhieb als erstaunlich wirksam und erlaubte den Patienten, mit einer neuen Leichtigkeit an den entscheidenden Riten des normalen Lebens innerhalb einer hochentwickelten Gesellschaft teilzuhaben, ohne dabei den Hang zu Selbstmord oder Selbstverstümmelung zu verstärken." Die bei Captorix am häufigsten beobachteten unerwünschten Nebenwirkungen waren Übelkeit, Libidoverlust und Impotenz. Florent-Claude Labrouste bleibt nur von einer verschont: "Unter Übelkeit habe ich nie gelitten."
Labrouste droht also, dem Leben abhanden zu kommen, entledigt sich zu Beginn des Romans seiner japanischen Freundin, indem er sein vorsätzliches Verschwinden inszeniert ("Die Entführung des Michel Houellebecq" heißt ein früherer Film von Guillaume Nicloux mit Houellebecq in der Rolle des Houellebecq, an den man hier gleich denken muss), und mietet sich in das offenbar letzte Raucherhotel in Paris ein, das "Mercure" an der Place d'Italie. Mit Captorix aber findet er wieder zurück, schafft es, sich zu waschen, sich die Zähne zu putzen, in eingeschränktem Maße am Sozialleben teilzunehmen. Doch ohne Verlangen, ohne Begehren: "die Vorstellung zu vögeln erschien mir fortan absurd".
Ein Houellebecq-Roman ohne Sex, ist das möglich? Kaum. Wenn schon Florent-Claude Labrouste keinen Sex mehr hat und auch keinen haben will, dann kann er anderen dabei zusehen. Er mag dabei angewidert sein oder lustlos, die ausführliche Schilderung leistet Houellebecq sich und uns dennoch: zum einen findet Labrouste Videoaufnahmen, die seine japanische Freundin inmitten eines Gangbangs zeigen und beim Sex mit Hunden (es sind Bilder, die ihn zu dem Entschluss führen, seine Lebensgefährtin zu verlassen); zum anderen kommt er später in der Normandie auf dem Land einem deutschen Ornithologen auf die Spur, den er, ebenfalls durch Bilder, die dieser auf dem Computer gespeichert hat, als Kinderschänder enttarnt.
Dass die sexuelle Befreiung - ursprünglich als Triumph über die Entfremdung in der autoritären Gesellschaft gefeiert - sich als letzte und entscheidende Strategie des sogenannten freien Marktes zur Zerstörung des Paares, der Familie, das heißt, der verbliebenen Gemeinschaften entpuppte: Das war Houellebecqs These in "Elementarteilchen". Wobei der Autor auf einen nicht unwesentlichen Widerspruch setzte: die sexuelle Befreiung einerseits zu dem zu erklären, was die Gemeinschaftsformen verfallen ließ, und andererseits in den Sexszenen, die Houellebecq berühmt gemacht haben, voll auszukosten, was diese sexuelle Befreiung möglich gemacht hat. In "Serotonin" - und das ist tatsächlich neu - kann davon keine Rede mehr sein. Wo im Roman von Sex die Rede ist, geht es (der Gangbang ist hier noch die harmloseste Variante) vor allem um Perversion und Verbrechen.
Nur die Liebe bleibt als großes Thema, die Liebe und die Möglichkeit von Glück: "Ich war in eine Nacht ohne Ende eingetreten, und doch blieb etwas, in meinem tiefsten Inneren blieb irgendetwas, weit weniger als eine Hoffnung, nennen wir es eine ,Ungewissheit'." Labrouste begibt sich im Roman auf eine Erinnerungsreise und auf die Suche nach jenen Frauen, mit denen er tatsächlich einmal glücklich war. Da ist die Dänin Kate ("Wir hätten die Welt retten können"), Claire, die Schauspielerin, und dann ist da noch die Tierärztin Camille, mit der er fünf Jahre zusammenlebte ("Ich war glücklich, noch nie war ich so glücklich gewesen"), bis er auf den "unseligen Einfall" kam, mit einer anderen zu schlafen.
Mit dem Ziel, sie wieder aufzusuchen, begibt er sich aufs Land, wo er zunächst auf seinen früher besten Freund Aymeric trifft, der Einzige aus seinem Jahrgang an der Landwirtschaftshochschule, der sich dafür entschied, auch Landwirt zu werden. Und genau hier sind wir dann bei dem, was den Roman gesellschaftspolitisch in gewisser Weise aktuell macht. Wobei es schon seltsam ist, dass sowohl in Frankreich als auch in Deutschland Besprechungen des neuen Romans zu lesen sind, die mit diesem Teil des Buchs beginnen und Houellebecq zugute halten, er habe einen "Gelbe Westen"-Roman geschrieben, ja, die Unruhen der "Gelben Westen" gewissermaßen vorhergesagt, so wie er in "Unterwerfung" das Pariser Attentat vorhergesagt habe (was auch nicht stimmte).
Labrouste mietet sich für eine Weile bei Aymeric auf dem Land in einem Bungalow ein und lässt sich von ihm das Schießen beibringen. Er hört ihm zu, wenn der von den ausländischen Investoren erzählt, denen er, um zu überleben, Parzellen seines Lands verkaufen muss, weil sie den doppelten Marktpreis bezahlen. Er versteht ihn, wenn Aymeric schildert, wie er sich an die Anforderungen des Bio-Siegels zu halten und alles korrekt zu machen versucht, auf diese Weise aber immer schlechter über die Runden kommt. Und er beobachtet, wie Aymeric sich mit den anderen Landwirten zusammenschließt, mit Pick-ups, Waffen und Benzinkanistern zur Autobahn aufbricht, um gegen den erneuten Rückgang der Milchpreise zu protestieren. Hier kommt es zur Katastrophe.
Es ist die spannendste Szene des Romans, es ist auch der Höhepunkt, wenngleich nicht das alles beherrschende Thema des Romans. Anders als Houellebecqs Beitrag im "Harper's Magazine" kommt diese Szene auch nicht als politisches Statement daher. Es heißt im Roman an einer Stelle, die Europäische Union habe sich "mit dieser Milchquoten-Geschichte wie eine alte Schlampe verhalten". Das stimmt. Aber das sagt nicht Houellebecq und auch nicht Labrouste. Labrouste denkt es, indem er sich in seinen Freund Aymeric hineinversetzt. Das ist schon ein Unterschied.
Worum es vielmehr geht, ist die Schilderung von zwei Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, der eine, ein Landwirt, mit erhobenem Sturmgewehr vor einer Reihe von Bereitschaftspolizisten auf der Autobahn auf der Suche nach Gerechtigkeit; der andere, ein Beamter des Landwirtschaftsministeriums, mit einer Waffe im Kofferraum auf der Suche nach Glück. Beide klammern sich an diese Waffen, als ob in ihrer Welt, in der alles verloren scheint, sich durch einen einzigen Schuss etwas ändern oder rückgängig machen ließe. Nur einer von ihnen drückt ab.
"Die meisten Menschen leben mit der Verzweiflung. Hin und wieder fragen sie sich trotzdem, ob sie sich zu einem Hauch von Hoffnung hinreißen lassen können, zumindest stellt sich die Frage, bevor sie sie verneinen. Dennoch machen sie beharrlich weiter, und das ist ein bewegendes Schauspiel." Von diesem Schauspiel erzählt "Serotonin", von einer Welt, in der eine kleine weiße teilbare Tablette einem Menschen zu leben oder zumindest nicht zu sterben hilft - über eine gewisse Zeit hinweg. Von hier aus gibt es, außer einem Rest metaphysischer Hoffnung, keinen Ausweg mehr. Es ist der mit Abstand dunkelste Roman von Michel Houellebecq.
JULIA ENCKE
Michel Houellebecq: "Serotonin". Roman. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. Verlag Dumont, 336 Seiten, 24 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Dirk Fuhrig sichert sich nach allen Seiten ab. Einerseits erkennt er in Michel Houellebecqs neuem Roman vor allem viele Eigenzitate und Selbstreferenzen, wenn der französische Großschrifsteller wie gehabt von einem mittelalten und mittelerfolgreichen Mittelschichtsmann mit "maximaler Depression" erzählt. Die Provokationen lässt Fuhr an sich abprallen, die Freizügigkeiten, die Verachtung der EU und der Unterschicht. Anderseits sieht er in dem Roman ein "bittersüßes, tieftrauriges und humoristisches Roadmovie", in dem der lebensüberdrüssige Florent-Claude in seinem Mercedes SUV Diesel durch ein zermürbtes Europa fährt (rasen darf er ja nicht). Und klar: Houellebecqs Stil und die ihm eigene Kombination aus Melancholie und schreiender Komik findet Fuhrig natürlich großartig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Hormone und Kummer
In Michel Houellebecqs neuem Roman „Serotonin“ ist der Held mutlos, die Libido erkaltet
und die Moderne menschenfeindlich. Es ist also alles wie immer
VON ALEX RÜHLE
Am Montag kommt der neue Houellebecq in die Buchhandlungen. Jedenfalls in Deutschland. In Frankreich hat man den Erscheinungstag auf Freitag vorgezogen, es wäre zu perfide gewesen, „Serotonin“ ausgerechnet am 7. Januar auszuliefern, dem Jahrestag des Charlie-Hebdo-Anschlags. Schließlich fiel das Attentat 2015 mit dem Erscheinungstag von Houellebecqs Roman „Unterwerfung“ zusammen, in dem ein gemäßigter Muslim Präsident wird, woraufhin das gesamte französische Establishment erstaunlich geschmeidig zum Islam konvertiert.
Am Morgen jenes 7. Januar saß Michel Houellebecq im Studio eines Radiosenders und sagte: „Die Republik ist tot.“ Und mit ihr Laizismus und Aufklärung: „Wir können drei Kreuze hinter der Aufklärung machen. Sie möge in Frieden ruhen.“ Als kurz darauf die Attentäter in die Redaktionskonferenz von Charlie Hebdo stürmten, lag auf dem Konferenztisch die aktuelle Ausgabe des Satiremagazins, auf dem Cover eine Karikatur, die Houellebecq als schrumpeligen Karnevals-Nostradamus zeigt. Mit am Tisch saß Houellebecqs Freund Bernard Maris, der in der Ausgabe den Roman hymnisch feierte. „Unterwerfung“ sei ein Meisterwerk, eine „außerordentlich glaubwürdige Zukunftsvision“, die sich keinesfalls über den Islam lustig mache. Maris wurde mittels Kopfschuss exekutiert, kurz darauf schrien die Mörder auf der Straße, sie hätten den Propheten gerächt.
Jetzt also der neue Roman des anderen Propheten. Die Franzosen überschlagen sich, Houellebecq habe schon wieder das zentrale politische Thema unserer Tage vorhergesehen, die „Gilets jaunes“, der Aufstand der unteren Mittelschicht in der Provinz, das sei doch da alles schon drin, in der Szene mit den verarmten normannischen Milchbauern, die die Autobahn blockieren und dann bewaffneten Polizeieinheiten gegenüberstehen…
Nun ist es ja wirklich erstaunlich, wie Houellebecqs Romane immer wieder die Wirklichkeit vorweggenommen oder kommentiert haben. „Plattform“, der Roman, an dessen Ende islamistische Terroristen ein Blutbad unter westlichen Touristen anrichten, erschien am 3. September 2001, eine Woche vor dem 11. September. Ein Jahr später wurden 202 Touristen auf Bali getötet, das Setting erinnerte auf unheimliche Art an den Roman. Wer nun aber „Serotonin“ kauft, um ein Handbuch über die aktuelle französische Krise zu erwerben, der wird selbstverständlich vorderhand enttäuscht. Die Bauern und ihr Protest (der brutal zusammengeschossen wird), tauchen nach Seite 200 auf, als kurzer, wenn auch eindrücklicher Nebenstrang.
Das Problem ist ein anderes. Houellebecq ist als Autor deshalb so erfolgreich und wichtig, weil er die desaströsen Folgen des Neoliberalismus, das Gefühl einer seelischen Verarmung und neonkalter Entfremdung eindringlich auf den Begriff gebracht hat. In einem frühen Essay hat er sich sein eigenes Epitaph geschrieben: „Jemand hat in den Neunzigerjahren deutlich die Entstehung eines monströsen und globalen Mangels verspürt; unfähig, das Phänomen klar zu umreißen, hat er uns jedoch – als Zeugnis seiner Inkompetenz – einige Gedichte hinterlassen.”
Seither hat Houellebecq dieses Phänomen freilich in derart vielen Romanen derart wortreich umrissen, dass die ersten 160 Seiten des neuen Buchs wirken, als seien sie von einem Houellebecq-Generator erschaffen worden: Florent-Claude Labrouste ist ein Mittvierziger ohne Freunde oder Interessen, der das Gefühl hat, total gescheitert zu sein, selbst seinen Vornamen Florent-Claude findet er missraten, weil er an eine „botticellihafte Schwuchtel“ erinnere. Beruflich erstellt er Studien für Verhandlungsdelegationen des Landwirtschaftsministeriums, die in Brüssel die Positionen der französischen Bauern stützen sollen, was seinem Autor die Möglichkeit bietet, gegen die EU und die tödlich bürokratische Spätmoderne zu wettern, der alle Bürger wehrlos ausgeliefert sind.
Anfangs lebt Labrouste mit Yuzu zusammen, einer Japanerin, die er inniglich verachtet, nicht erst, seit er auf ihrem Rechner ein Video gefunden hat, auf dem sie Sex mit mehreren Hunden hat. Nach dieser Entdeckung will er sie erst aus dem Fenster seiner Wohnung werfen, was er dann nur deshalb nicht macht, weil er doch an den Annehmlichkeiten der Freiheit hängt, die freilich in unseren verkrüppelten Zeiten nichts mehr mit dem Entwurf eines selbstbestimmten Lebens zu tun hat, sondern sich in täglichen Gängen zum Supermarkt erschöpft, wo er zwischen 14 Arten von Hummus wählen kann.
Da er die ersten Seiten mit Yuzu in einer Nudistenkolonie in Spanien verbringt, auch dieses Setting kennen Houellebecq-Leser zur Genüge, kann er zum einen Nationalitätenklischees vom Stapel lassen, „die Holländer, das waren wirklich Schlampen, ein Volk polyglotter Kaufmänner und Opportunisten, diese Holländer, man kann es gar nicht oft genug sagen“, weshalb er das dann oft genug sagt. Zum anderen bietet Houellebecq das Nudistensetting einmal mehr die Möglichkeit, alternde Frauen als welke Fleischsäcke zu skizzieren. Daneben gibt es natürlich unfassbar geile junge Schnitten. Beide Arten von Frauen werden vor allem als Schlampen tituliert. Ansonsten hasst Labrouste Mülltrennung und Paris mit seinen umweltbewussten Kleinbürgern. Er ist überzeugter Diesel-SUV-Fahrer und weiß: „Ich hatte nicht viel Gutes im Leben getan, aber zumindest würde ich meinen Teil zur Zerstörung des Planeten beigetragen haben“.
Um es mal in seiner eigenen Metaphorik zu sagen: Mitte der Neunzigerjahre wirkten diese Schimpfereien noch sehnig, straff und unverbraucht. Jetzt kommt einem der sehr lange Anfang dieses Romans vor wie ein welker, unglücklich gealterter Textsack, in den nach der gängigen Rezeptur natürlich auch noch Islamophobie, Schwulenhäme und sehr viel Alkohol und Psychopharmaka gestopft werden.
Das Ganze nimmt erst Fahrt auf, als Labrouste sich entschließt zu kündigen und spurlos zu verschwinden. Was folgt, ist eine Reise ins wirtschaftliche Elend der Provinz und in die eigene qualvolle Erinnerung. Er sucht seinen einzigen ehemaligen Freund auf, Nachkomme eines Adelsgeschlechts, der versucht, als Milchbauer nebst Tourismusbetrieb zu leben. Da ihn aber seine Frau, „diese Schlampe“, zugunsten eines kosmopolitischen Pianisten verlassen hat, sind er und der Hof völlig verdreckt und verkommen. Außerdem natürlich die fiese EU, gesenkte Milchquoten, Labrouste als ehemaliger Ministeriumsmitarbeiter weiß, dass es da einen riesigen „Entlassungsplan“ gibt, demzufolge die Zahl der Milchbauern auf ein Viertel gesenkt werden soll, „ein geheimer, unsichtbarer Entlassungsplan, bei dem die Leute unabhängig voneinander verschwinden“.
Wer nun in die Falle der Empörung tappt, weil da in politisch brisanten Zeiten en passant Verschwörungstheorien eingeschleust werden oder weil Labrouste gar nicht aufhören kann mit seinem Schlampengerede, ist natürlich selber schuld, weil: Houellebecq liebt es ja zu provozieren. Kurz vor dem Erscheinen des Romans lobte der alte Spaßvogel in einem US-Magazin Donald Trump. Und Fuchs, der er ist, hat er auch wieder ein starkes Relativierungssignal eingebaut. Das titelgebende Serotonin ist der Wirkstoff eines Antidepressivums, das Labrouste fürs Erste davon abhält, sich umzubringen. Der Autor aber nutzt es als erzählerisches Distanzierungsmittel, indem er mehrfach betont, dass diese Tablette „nichts erschafft, und nichts verändert. Sie liefert eine neue Interpretation des Lebens.“ Alles Ansichtssache also, das Geschimpfe über Schlampen genauso wie der Politpopulismus. Dass er damit längst auch zum Helden vieler extrem identitär schillernder Leser wurde – was willste machen, man ist ja nicht verantwortlich dafür, wer einen liest.
Nur eines wirkt echt: der Lebensschmerz. Die Trauer um Camille, seine große Liebe, die er aufgrund eines dämlichen Seitensprungs verloren hat und der er nun hinterherreist. In ihm reift der wahnsinnige Plan, ihren Sohn zu erschießen, um sie so für sich zurückzugewinnen. In diesem Schlussteil zeigt Houellebecq, was er kann, Krimi, Groteske, Liebesroman, Sozialreportage, alles wird angespielt und zitiert, aber wozu noch wirklich ernsthaft erzählen, wenn man feststellt, dass es selbst in den größten Kunstwerken, in Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“ am Ende einzig um „junge, feuchte Muschis“ und in Thomas Manns „Zauberberg“ nur um „beherzt aufgestellte junge Schwänze“ geht?
Labrouste ist sich am Ende sicher, dass ihm nur der Freitod bleibt, als Sturz aus dem Fenster seiner Hochhauswohnung. Diese Einsamkeitspassagen sind streckenweise erschütternd. Gleichzeitig denkt man, na ja, 200 Seiten lang alle nur als Schlampen beschimpfen und dann auf den letzten Metern Einsamkeit und Verlust beklagen, vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang. Aber das wäre natürlich wieder nur typisch schwules Pariser Gutmenschengerede.
Michel Houellebecq: Serotonin. Roman. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. Dumont Verlag, Köln 2019. 336 S., 24 Euro.
Erstaunlich, wie Houellebecqs
Romane oft die
Wirklichkeit vorwegnehmen
Krimi, Groteske, Liebesroman:
Im Schlussteil zeigt
Houellebecq, was er kann
In der französischen Kritik heißt es, Houellebecq habe schon wieder die Zukunft vorausgesehen. Der Aufstand der Provinz ist in „Serotonin“ aber nur ein Nebenstrang.
Foto: FRANÇOIS LO PRESTI / AFP
Prophet des Untergangs: Michel
Houellebecq. Foto: MARTIN BUREAU / AFP
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
In Michel Houellebecqs neuem Roman „Serotonin“ ist der Held mutlos, die Libido erkaltet
und die Moderne menschenfeindlich. Es ist also alles wie immer
VON ALEX RÜHLE
Am Montag kommt der neue Houellebecq in die Buchhandlungen. Jedenfalls in Deutschland. In Frankreich hat man den Erscheinungstag auf Freitag vorgezogen, es wäre zu perfide gewesen, „Serotonin“ ausgerechnet am 7. Januar auszuliefern, dem Jahrestag des Charlie-Hebdo-Anschlags. Schließlich fiel das Attentat 2015 mit dem Erscheinungstag von Houellebecqs Roman „Unterwerfung“ zusammen, in dem ein gemäßigter Muslim Präsident wird, woraufhin das gesamte französische Establishment erstaunlich geschmeidig zum Islam konvertiert.
Am Morgen jenes 7. Januar saß Michel Houellebecq im Studio eines Radiosenders und sagte: „Die Republik ist tot.“ Und mit ihr Laizismus und Aufklärung: „Wir können drei Kreuze hinter der Aufklärung machen. Sie möge in Frieden ruhen.“ Als kurz darauf die Attentäter in die Redaktionskonferenz von Charlie Hebdo stürmten, lag auf dem Konferenztisch die aktuelle Ausgabe des Satiremagazins, auf dem Cover eine Karikatur, die Houellebecq als schrumpeligen Karnevals-Nostradamus zeigt. Mit am Tisch saß Houellebecqs Freund Bernard Maris, der in der Ausgabe den Roman hymnisch feierte. „Unterwerfung“ sei ein Meisterwerk, eine „außerordentlich glaubwürdige Zukunftsvision“, die sich keinesfalls über den Islam lustig mache. Maris wurde mittels Kopfschuss exekutiert, kurz darauf schrien die Mörder auf der Straße, sie hätten den Propheten gerächt.
Jetzt also der neue Roman des anderen Propheten. Die Franzosen überschlagen sich, Houellebecq habe schon wieder das zentrale politische Thema unserer Tage vorhergesehen, die „Gilets jaunes“, der Aufstand der unteren Mittelschicht in der Provinz, das sei doch da alles schon drin, in der Szene mit den verarmten normannischen Milchbauern, die die Autobahn blockieren und dann bewaffneten Polizeieinheiten gegenüberstehen…
Nun ist es ja wirklich erstaunlich, wie Houellebecqs Romane immer wieder die Wirklichkeit vorweggenommen oder kommentiert haben. „Plattform“, der Roman, an dessen Ende islamistische Terroristen ein Blutbad unter westlichen Touristen anrichten, erschien am 3. September 2001, eine Woche vor dem 11. September. Ein Jahr später wurden 202 Touristen auf Bali getötet, das Setting erinnerte auf unheimliche Art an den Roman. Wer nun aber „Serotonin“ kauft, um ein Handbuch über die aktuelle französische Krise zu erwerben, der wird selbstverständlich vorderhand enttäuscht. Die Bauern und ihr Protest (der brutal zusammengeschossen wird), tauchen nach Seite 200 auf, als kurzer, wenn auch eindrücklicher Nebenstrang.
Das Problem ist ein anderes. Houellebecq ist als Autor deshalb so erfolgreich und wichtig, weil er die desaströsen Folgen des Neoliberalismus, das Gefühl einer seelischen Verarmung und neonkalter Entfremdung eindringlich auf den Begriff gebracht hat. In einem frühen Essay hat er sich sein eigenes Epitaph geschrieben: „Jemand hat in den Neunzigerjahren deutlich die Entstehung eines monströsen und globalen Mangels verspürt; unfähig, das Phänomen klar zu umreißen, hat er uns jedoch – als Zeugnis seiner Inkompetenz – einige Gedichte hinterlassen.”
Seither hat Houellebecq dieses Phänomen freilich in derart vielen Romanen derart wortreich umrissen, dass die ersten 160 Seiten des neuen Buchs wirken, als seien sie von einem Houellebecq-Generator erschaffen worden: Florent-Claude Labrouste ist ein Mittvierziger ohne Freunde oder Interessen, der das Gefühl hat, total gescheitert zu sein, selbst seinen Vornamen Florent-Claude findet er missraten, weil er an eine „botticellihafte Schwuchtel“ erinnere. Beruflich erstellt er Studien für Verhandlungsdelegationen des Landwirtschaftsministeriums, die in Brüssel die Positionen der französischen Bauern stützen sollen, was seinem Autor die Möglichkeit bietet, gegen die EU und die tödlich bürokratische Spätmoderne zu wettern, der alle Bürger wehrlos ausgeliefert sind.
Anfangs lebt Labrouste mit Yuzu zusammen, einer Japanerin, die er inniglich verachtet, nicht erst, seit er auf ihrem Rechner ein Video gefunden hat, auf dem sie Sex mit mehreren Hunden hat. Nach dieser Entdeckung will er sie erst aus dem Fenster seiner Wohnung werfen, was er dann nur deshalb nicht macht, weil er doch an den Annehmlichkeiten der Freiheit hängt, die freilich in unseren verkrüppelten Zeiten nichts mehr mit dem Entwurf eines selbstbestimmten Lebens zu tun hat, sondern sich in täglichen Gängen zum Supermarkt erschöpft, wo er zwischen 14 Arten von Hummus wählen kann.
Da er die ersten Seiten mit Yuzu in einer Nudistenkolonie in Spanien verbringt, auch dieses Setting kennen Houellebecq-Leser zur Genüge, kann er zum einen Nationalitätenklischees vom Stapel lassen, „die Holländer, das waren wirklich Schlampen, ein Volk polyglotter Kaufmänner und Opportunisten, diese Holländer, man kann es gar nicht oft genug sagen“, weshalb er das dann oft genug sagt. Zum anderen bietet Houellebecq das Nudistensetting einmal mehr die Möglichkeit, alternde Frauen als welke Fleischsäcke zu skizzieren. Daneben gibt es natürlich unfassbar geile junge Schnitten. Beide Arten von Frauen werden vor allem als Schlampen tituliert. Ansonsten hasst Labrouste Mülltrennung und Paris mit seinen umweltbewussten Kleinbürgern. Er ist überzeugter Diesel-SUV-Fahrer und weiß: „Ich hatte nicht viel Gutes im Leben getan, aber zumindest würde ich meinen Teil zur Zerstörung des Planeten beigetragen haben“.
Um es mal in seiner eigenen Metaphorik zu sagen: Mitte der Neunzigerjahre wirkten diese Schimpfereien noch sehnig, straff und unverbraucht. Jetzt kommt einem der sehr lange Anfang dieses Romans vor wie ein welker, unglücklich gealterter Textsack, in den nach der gängigen Rezeptur natürlich auch noch Islamophobie, Schwulenhäme und sehr viel Alkohol und Psychopharmaka gestopft werden.
Das Ganze nimmt erst Fahrt auf, als Labrouste sich entschließt zu kündigen und spurlos zu verschwinden. Was folgt, ist eine Reise ins wirtschaftliche Elend der Provinz und in die eigene qualvolle Erinnerung. Er sucht seinen einzigen ehemaligen Freund auf, Nachkomme eines Adelsgeschlechts, der versucht, als Milchbauer nebst Tourismusbetrieb zu leben. Da ihn aber seine Frau, „diese Schlampe“, zugunsten eines kosmopolitischen Pianisten verlassen hat, sind er und der Hof völlig verdreckt und verkommen. Außerdem natürlich die fiese EU, gesenkte Milchquoten, Labrouste als ehemaliger Ministeriumsmitarbeiter weiß, dass es da einen riesigen „Entlassungsplan“ gibt, demzufolge die Zahl der Milchbauern auf ein Viertel gesenkt werden soll, „ein geheimer, unsichtbarer Entlassungsplan, bei dem die Leute unabhängig voneinander verschwinden“.
Wer nun in die Falle der Empörung tappt, weil da in politisch brisanten Zeiten en passant Verschwörungstheorien eingeschleust werden oder weil Labrouste gar nicht aufhören kann mit seinem Schlampengerede, ist natürlich selber schuld, weil: Houellebecq liebt es ja zu provozieren. Kurz vor dem Erscheinen des Romans lobte der alte Spaßvogel in einem US-Magazin Donald Trump. Und Fuchs, der er ist, hat er auch wieder ein starkes Relativierungssignal eingebaut. Das titelgebende Serotonin ist der Wirkstoff eines Antidepressivums, das Labrouste fürs Erste davon abhält, sich umzubringen. Der Autor aber nutzt es als erzählerisches Distanzierungsmittel, indem er mehrfach betont, dass diese Tablette „nichts erschafft, und nichts verändert. Sie liefert eine neue Interpretation des Lebens.“ Alles Ansichtssache also, das Geschimpfe über Schlampen genauso wie der Politpopulismus. Dass er damit längst auch zum Helden vieler extrem identitär schillernder Leser wurde – was willste machen, man ist ja nicht verantwortlich dafür, wer einen liest.
Nur eines wirkt echt: der Lebensschmerz. Die Trauer um Camille, seine große Liebe, die er aufgrund eines dämlichen Seitensprungs verloren hat und der er nun hinterherreist. In ihm reift der wahnsinnige Plan, ihren Sohn zu erschießen, um sie so für sich zurückzugewinnen. In diesem Schlussteil zeigt Houellebecq, was er kann, Krimi, Groteske, Liebesroman, Sozialreportage, alles wird angespielt und zitiert, aber wozu noch wirklich ernsthaft erzählen, wenn man feststellt, dass es selbst in den größten Kunstwerken, in Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“ am Ende einzig um „junge, feuchte Muschis“ und in Thomas Manns „Zauberberg“ nur um „beherzt aufgestellte junge Schwänze“ geht?
Labrouste ist sich am Ende sicher, dass ihm nur der Freitod bleibt, als Sturz aus dem Fenster seiner Hochhauswohnung. Diese Einsamkeitspassagen sind streckenweise erschütternd. Gleichzeitig denkt man, na ja, 200 Seiten lang alle nur als Schlampen beschimpfen und dann auf den letzten Metern Einsamkeit und Verlust beklagen, vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang. Aber das wäre natürlich wieder nur typisch schwules Pariser Gutmenschengerede.
Michel Houellebecq: Serotonin. Roman. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. Dumont Verlag, Köln 2019. 336 S., 24 Euro.
Erstaunlich, wie Houellebecqs
Romane oft die
Wirklichkeit vorwegnehmen
Krimi, Groteske, Liebesroman:
Im Schlussteil zeigt
Houellebecq, was er kann
In der französischen Kritik heißt es, Houellebecq habe schon wieder die Zukunft vorausgesehen. Der Aufstand der Provinz ist in „Serotonin“ aber nur ein Nebenstrang.
Foto: FRANÇOIS LO PRESTI / AFP
Prophet des Untergangs: Michel
Houellebecq. Foto: MARTIN BUREAU / AFP
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Dirk Fuhrig sichert sich nach allen Seiten ab. Einerseits erkennt er in Michel Houellebecqs neuem Roman vor allem viele Eigenzitate und Selbstreferenzen, wenn der französische Großschrifsteller wie gehabt von einem mittelalten und mittelerfolgreichen Mittelschichtsmann mit "maximaler Depression" erzählt. Die Provokationen lässt Fuhr an sich abprallen, die Freizügigkeiten, die Verachtung der EU und der Unterschicht. Anderseits sieht er in dem Roman ein "bittersüßes, tieftrauriges und humoristisches Roadmovie", in dem der lebensüberdrüssige Florent-Claude in seinem Mercedes SUV Diesel durch ein zermürbtes Europa fährt (rasen darf er ja nicht). Und klar: Houellebecqs Stil und die ihm eigene Kombination aus Melancholie und schreiender Komik findet Fuhrig natürlich großartig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Der umwerfendste Schriftsteller unserer Gegenwart.« Julia Encke, F. A. S.