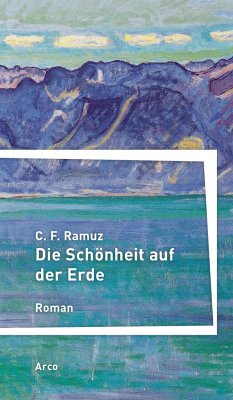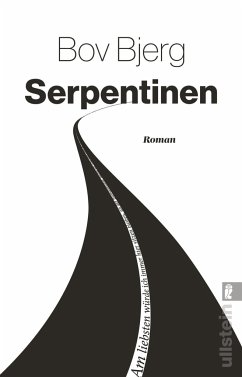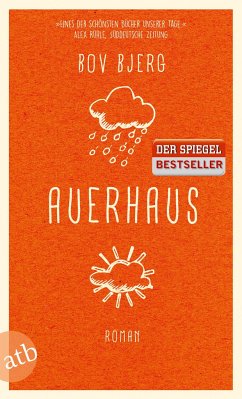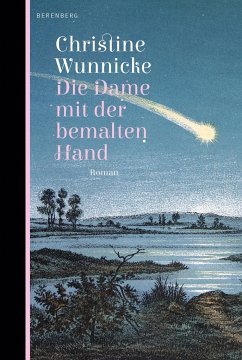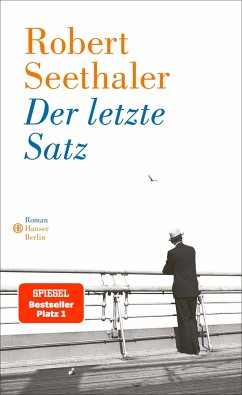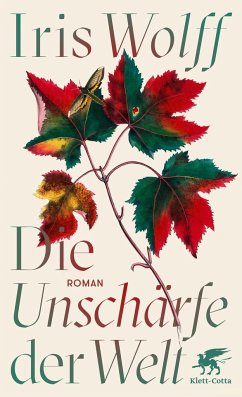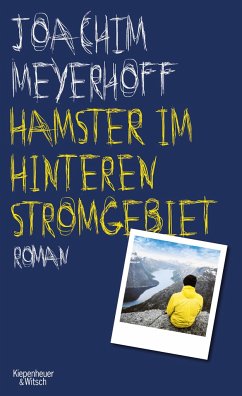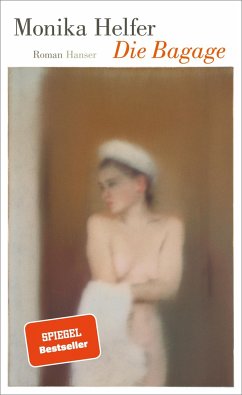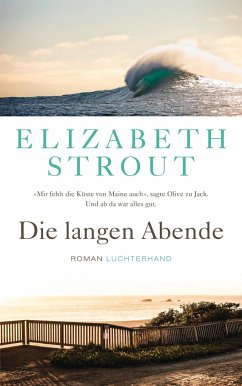Nicht lieferbar
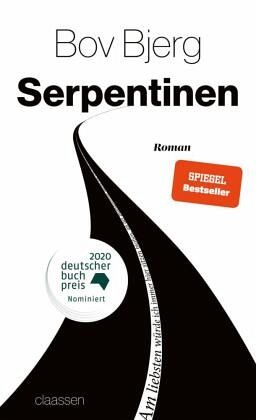
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Ein Vater unterwegs mit seinem Sohn. Ihre Reise führt zurück in das Hügelland, aus dem der Vater stammt, zu den Schauplätzen seiner Kindheit. Da ist das Geburtshaus, dort die elterliche Hochzeitskirche, hier der Friedhof, auf dem der Freund Frieder begraben liegt. Ständiger Reisebegleiter ist das Schicksal der männlichen Vorfahren, die sich allesamt das Leben nahmen: "Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt." Der Vater muss erkennen, dass sein Wegzug, seine Bildung und sein Aufstieg keine Erlösung gebracht haben.Vielleicht helfen die Rückkehr und das Erinnern. ...
Ein Vater unterwegs mit seinem Sohn. Ihre Reise führt zurück in das Hügelland, aus dem der Vater stammt, zu den Schauplätzen seiner Kindheit. Da ist das Geburtshaus, dort die elterliche Hochzeitskirche, hier der Friedhof, auf dem der Freund Frieder begraben liegt. Ständiger Reisebegleiter ist das Schicksal der männlichen Vorfahren, die sich allesamt das Leben nahmen: "Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt." Der Vater muss erkennen, dass sein Wegzug, seine Bildung und sein Aufstieg keine Erlösung gebracht haben.
Vielleicht helfen die Rückkehr und das Erinnern. Doch warum bringt er seinen Jungen in Gefahr? Warum hat er keine Antwort auf dessen bange Frage: "Um was geht es?" Er weiß nur: Wer zurückfährt, muss alle Kurven noch einmal nehmen. Wenn er der dunklen Tradition ein Ende setzen will.
Bov Bjerg gehört zu den wichtigsten Schriftstellern der deutschen Gegenwart. Nach dem Bestseller "Auerhaus" legt er nun seinen neuen Roman vor. Genau, mutig und lang nachwirkend erzählt er vom Kampf eines Vaters gegen die Dämonen der Vergangenheit. Nur wenn er seinen Sohn so liebt, wie er selbst nie geliebt wurde, kann die Reise der beiden glücken.
Vielleicht helfen die Rückkehr und das Erinnern. Doch warum bringt er seinen Jungen in Gefahr? Warum hat er keine Antwort auf dessen bange Frage: "Um was geht es?" Er weiß nur: Wer zurückfährt, muss alle Kurven noch einmal nehmen. Wenn er der dunklen Tradition ein Ende setzen will.
Bov Bjerg gehört zu den wichtigsten Schriftstellern der deutschen Gegenwart. Nach dem Bestseller "Auerhaus" legt er nun seinen neuen Roman vor. Genau, mutig und lang nachwirkend erzählt er vom Kampf eines Vaters gegen die Dämonen der Vergangenheit. Nur wenn er seinen Sohn so liebt, wie er selbst nie geliebt wurde, kann die Reise der beiden glücken.
Bov Bjerg, geboren 1965, ist Schriftsteller und Vorleser. Sein erster Roman hieß »Deadline«, sein zweiter, »Auerhaus«, wurde verfilmt und von vielen Theatern inszeniert. Eine Geschichtensammlung erschien unter dem Titel »Die Modernisierung meiner Mutter«.
Mit »Serpentinen« war Bov Bjerg auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2020.
Mit »Serpentinen« war Bov Bjerg auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2020.
Produktdetails
- Verlag: Claassen Verlag
- 5. Aufl.
- Seitenzahl: 272
- Erscheinungstermin: 23. Januar 2020
- Deutsch
- Abmessung: 214mm x 136mm x 32mm
- Gewicht: 460g
- ISBN-13: 9783546100038
- ISBN-10: 3546100034
- Artikelnr.: 57807617
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensent Rainer Moritz zeigt sich enttäuscht von Bov Bjergs Erinnerungsbuch. Es ist nicht der im Vergleich zu Bjergs Erfolgsroman "Auerhaus" düstere Ton, der ihn stört oder dass Bjerg diesmal keine lustigen Anekdoten zu erzählen hat, sondern sich mit dem Selbstmord seines Vaters und dessen Nazismus auseinandersetzt. Die Lektüre bietet ihm "bewegende Szenen", Sätze, in denen die erlittene Grausamkeit und Verzweiflung des Kindes stecken. Wirklich störend scheint Moritz hingegen, wie der Autor sich als "sich selbst kasteienden Kommentator" inszeniert, der gegen den Schwabenkitsch, das finstere Erbe und das bougeoise Milieu wettert, in dem er sich selber gefangen sieht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
" Ein analytisch angewandter Existenzialismus als philosophische Richtschnur, dem man dringend ein Revival wünscht." Matthias Ehlert Die Zeit 20200213
Der Schwarze Gott
Mit seinem neuen Roman «Serpentinen» hat der Schriftsteller Bov Bjerg eine düstere Thematik aufgegriffen, es geht um scheinbar schicksalhaft von Generation zu Generation weitervererbte Depressionen, die im Suizid enden. Kein Wohlfühlroman also, sondern eine …
Mehr
Der Schwarze Gott
Mit seinem neuen Roman «Serpentinen» hat der Schriftsteller Bov Bjerg eine düstere Thematik aufgegriffen, es geht um scheinbar schicksalhaft von Generation zu Generation weitervererbte Depressionen, die im Suizid enden. Kein Wohlfühlroman also, sondern eine bedrückende Schilderung des verzweifelten Versuchs eines Vaters, der unheilvollen familiären Prägung durch einen intensiven Prozess des Erinnerns zu entgehen und damit auch seinen Sohn aus dieser vermeintlichen Teufelsspirale zu befreien.
Der Ich-Erzähler Höppner ist ein auf Statistik spezialisierter, hoch angesehener Soziologie-Professor aus Berlin, der mit der deutlich jüngeren Rechtsanwältin M verheiratet ist und mit ihr einen namenlos bleibenden, siebenjährigen Sohn hat. In seiner Familie haben die väterlichen Ahnen allesamt Suizid begangen. «Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt. Pioniere zu Wasser, zu Land und in der Luft» heißt es im Roman. Er leidet selbst unter schweren Depressionen, hat seine Therapie aber als nutzlos abgebrochen. Stattdessen reist er mit seinem Sohn nun auf die Schwäbische Alb, zu den Schauplätzen seiner Kindheit. Diese Reise in die Vergangenheit, deren Sinn «der Junge», in der Geschichte ebenso unpersönlich wie die Mutter benannt, einfach nicht begreift. «Um was geht es?» lautet denn auch seine häufig wiederholte Frage. Was für Höppner als Rettungsanker aus seiner Psychose dienen soll, um diese fatale Schicksalskette zu durchbrechen, ist für den Sohn als so gar nicht kindgerechte Reise eher eine Zumutung, die er jedoch geduldig erträgt.
Bei Churchill und Chaplin, prominente Leidensgenossen des Ich Erzählers, der ‹schwarze Hund› genannt, das anfallartige Auftreten schwerer Depressionen nämlich, wird hier im Roman als «Schwarzer Gott» bezeichnet. Die Autotour mit dem Sohn soll dazu dienen, sich von diesem Familienfluch zu befreien, seine dadurch geweckten Erinnerungen sind jedoch eher dazu geeignet, ihn herunter zu ziehen als aufzurichten. Es kommt so weit, dass er völlig verzweifelt nach abrahamschem Vorbild sogar zur Opferung seines Sohnes bereit ist, ihn mit einem Kissen ersticken will. In 45 manchmal nur aus wenigen Zeilen bestehenden Kapiteln berichtet Bov Bjerg anekdotisch von vielen prägenden und zumeist unerfreulichen Ereignissen im Leben Höppners. Dabei wird oft unvermittelt zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her gependelt, der Buchtitel scheint sich damit eher auf den kurvenreichen Plot zu beziehen als auf die psychischen Verwerfungen bei der verzweifelten Identitätssuche, über die da berichtet wird. «Diese Scheißwut der Scheißväter, gegen sich, gegen alle. Die Kinder mussten für die Kindheit ihrer Väter büßen. Ich war auch nur ein Scheißvater» sinniert der selbstzweiflerische Ich-Erzähler in seinem permanenten Lebensschmerz. Seine ergebnislosen Grübeleien münden in den Satz: «Als ob ein Suizid das Ergebnis einer logischen Operation wäre», man kann ihn als Beweis für das ständige Ringen des Erzählers mit den Dämonen deuten, die ihn im Traum heimsuchen.
Die schonungslose Offenheit, mit der hier eine Familientragödie beschrieben wird, offenbart auf eindrucksvolle Weise die Bodenlosigkeit einer tückischen Psychose, die zur Obsession des Ich-Erzählers geworden ist und all sein Denken bestimmt. All das wird jedoch stilistisch unterkühlt in einer sperrigen Prosa ziemlich schleppend erzählt. Man muss sich als Leser besonders am Anfang geradezu quälen, um irgendwie hinein zu kommen in diese von weitgehender Emotionslosigkeit dominierte, melancholische Geschichte. Als beste Momente beim Lesen erweisen sich die giftigen Kommentare über die Nazivergangenheit des Vaters sowie die vehementen Ausfälle gegen eine zeitgenössische, akademische Bourgeoisie, die sich zum Stehempfang trifft und der Höppner als Professor ebenfalls angehört. Wenn da nur nicht immer auch der Schwarze Gott im Hintergrund lauern würde, den er mit viel Alkohol vergebens zu bekämpfen sucht, - wie schon seine Väter!
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Satirischer Selbstmordroman
Was wie ein Widerspruch klingt, verbindet dieses Buch meisterhaft. Der düsteren Ton ist zumindest anfangs von zahlreichen Pointen durchsetzt und sehr witzig: „Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt. Zu Wasser, zu …
Mehr
Satirischer Selbstmordroman
Was wie ein Widerspruch klingt, verbindet dieses Buch meisterhaft. Der düsteren Ton ist zumindest anfangs von zahlreichen Pointen durchsetzt und sehr witzig: „Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft.“ (5)
Ständige Nazivergleiche: „Ich sah Autobahnen und dachte: Nazis.
Ich sah Gleise und dachte: Deportationen." (14) , ja selbst das Üben des Einmaleins endet so.
Der inzwischen in Berlin lebende Ich-Erzähler reist mit seinem 7-jährigen Jungen in die schwäbische Alb, wo er aufgewachsen ist. Da darf ein Seitenhieb auf Stuttgart 21 nicht fehlen: „Die GROSSE ABKÜRZUNG sparte viel Zeit auf der Strecke von Paris nach Bratislava, also von Stuttgart nach Ulm. Fünf Minuten, zwanzig Sekunden schneller im Osten.“ (15)
Weil seine Mutter aus dem Südböhmen und sein Vater aus Brandenburg stammt, fühlte er aber sich nicht dazu gehörig. Seine katholische Konfession teilte er nicht mit den Ureinwohner. Dennoch gefällt mir sein satirischer Umgang mit der Religion: „Im Innern der Kirche war alles weiß und golden und geschnörkelt. Sie hatten den lieben Gott ein riesiges Mädchenzimmer hingestellt.“ (24)
Auch ein Mönch bekommt sein Fett weg: „Rauchen durfte er, ficken nicht. Eine eigenartige Religion.“ (28) Am stärksten ist wohl die Stelle, wo der Selbstmord der Väter religiös überhöht wird: „Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird.
Mein Hals, der für euch und für alle erdrosselt wird.
Mein Kopf, der für euch und für alle erschossen wird.“ (33)
Am meisten stimme ich mit dem Autor überein, wo er die Landschaft in Wasserscheiden trennt: „Ich wollte eine Landkarte, auf der man sehen konnte, wohin der Urin floss, wenn man in den Garten pinkelte.“ (41) und später von Donaueuropa und Rheineuropa spricht.
Aber um die Seite 200 fehlt mir dann doch ein wenig Handlung. Es häufen sich die Rückblenden in sein Berliner Leben, wo er vor allem dank seiner Frau am gesellschaftlichem Leben teilnimmt:
Er sagte: „Darf ich Ihnen ein Glas bringen?“
Ich sagte: „Nein, danke, nicht nötig.“
Er sagte: „Ich bringe Ihnen ein Glas.“ (119)
Auch diese bleibt nicht ohne Kritik: M. sagte: „Weißt du, was beim Kellnern die blödesten Gäste waren? Die, die aus Mitleid niemals Trinkgeld gegeben haben. Aus Bescheidenheit! Um sich nicht zu erhöhen.“ (151f)
Das Ende ist wieder spannend und wird nicht verraten. Dafür dieses hübsche Kinderrätsel:
„Die Mutter von Fritzchen hat drei Kinder: Tsching, Tschang und?“
„Tschong.“
„Falsch. Fritzchen.“ (227f)
Nach außergewöhnlich starkem Beginn lässt die Anzahl der Pointen etwas nach. Richtig ist auch, dass Bjerg mal ein Buch ohne das Thema Selbstmord schreiben könnte. 4 Sterne
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Bedrückende Atmosphäre. Konzept: ja, roter Faden: nein.
Vor der Lektüre von „Serpentinen“ kannte ich den Autor Bov Bjerg nicht. Da sein Buch aber teilweise auf der Schwäbischen Alb (der Heimat des Autors) spielt, Depressionen und Selbstmord in meinem Leben schon eine …
Mehr
Bedrückende Atmosphäre. Konzept: ja, roter Faden: nein.
Vor der Lektüre von „Serpentinen“ kannte ich den Autor Bov Bjerg nicht. Da sein Buch aber teilweise auf der Schwäbischen Alb (der Heimat des Autors) spielt, Depressionen und Selbstmord in meinem Leben schon eine große Rolle gespielt haben, hat mich das Buch sehr interessiert.
Die durchgehend düstere, nebulöse und nicht-greifbare Stimmung in dem Roman fand ich gewöhnungsbedürftig. Die unterschwellige Depression und die vielen unausgesprochenen Dinge ebenfalls. Aber die größten Probleme hatte ich mit der Sprache des Autors: abgehackt, fragmentiert und alles in allem für mich eher leserunfreundlich.
Das Buch hinterließ bei mir am Ende ein ziemlich großes Fragezeichen und einen eher schalen Nachgeschmack. Die Geschichte schlängelt sich serpentinengleich in alle möglichen Richtungen, um dann irgendwann wieder am eigentlichen Thema zu landen, von wo aus der Autor dann wieder abschweift. Einen roten Faden, der mich hätte fesseln können, konnte ich keinen finden. Depressionen, Familientragödien und Selbstmord(e) sind schwierige Themen, die der Autor für meinen Geschmack nicht wirklich gut aufarbeitet. Vielleicht fehlt mir das Vorwissen aus seinem Roman „Auerhaus“, um das Werk richtig einordnen zu können. Von mir leider keine Lese-Empfehlung, 2 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Der Ich-Erzähler des Buches scheint Alles erreicht zu haben: glückliche Ehe und ein gesundes Kind, erfolgreich und anerkannt im Beruf. Doch das Erlebte seiner Kindheit ist nicht vergessen: die Selbstmorde seines Vater, Großvaters und Urgroßvaters, die ihn fürchten lassen, …
Mehr
Der Ich-Erzähler des Buches scheint Alles erreicht zu haben: glückliche Ehe und ein gesundes Kind, erfolgreich und anerkannt im Beruf. Doch das Erlebte seiner Kindheit ist nicht vergessen: die Selbstmorde seines Vater, Großvaters und Urgroßvaters, die ihn fürchten lassen, selbst der Nächste zu sein. Die Misshandlungen durch Vater, Mutter und Stiefvater, die sich derart tief eingegraben haben, dass er immer wieder feststellen muss, dass er zu ähnlichen Verhaltensmustern neigt. Seine ärmliche Herkunft aus dem Schwäbischen die ihn glauben lässt, dass er selbst als anerkannter Teil der Hochschule, Professor und Koryphäe seines Fachs, seinen Kolleginnen und Kollegen bürgerlicher Herkunft nicht ebenbürtig sei. Als er mit seinem kleinen Sohn eine Reise in seine schwäbische Heimat unternimmt, brechen all die Erinnerungen, Verletzungen und Demütigungen mit enormer Kraft hervor und es ist klar: Um seinem Sohn ein guter Vater zu sein, muss er seine Vergangenheit hinter sich lassen.
Ein einfaches Lesevergnügen ist dieses Buch wahrlich nicht, denn der Erzählstil ist nicht gerade einladend. Den chronologischen Rahmen bildet die Reise des Ich-Erzählers mit seinem Sohn, währenddessen er immer wieder in kurzen Episoden aus der Vergangenheit schildert, sowohl von seiner Kindheit und Jugend wie auch seiner Zeit als Ehemann und Vater. Die Sätze sind meist kurz und knapp und klingen stakkatohaft, wie getrieben, wohl um den Gefühlszustand des Erzählers wiederzugeben. Namensnennungen gibt es nur für Personen, die ihm nicht (mehr) nahe stehen, während beispielsweise seine Frau M. heißt und der Sohn nur ‚der Junge‘ genannt wird. Hinzu kommt eine recht überschaubare Handlung, sodass alles zusammen genommen kein richtiger Erzählfluss entsteht.
Doch der Autor besitzt die Kunst, Situationen überaus anschaulich zu beschreiben. Beispielsweise über seine Mutter, die als Flüchtling auf die Schwäbische Alb kam, Schwäbisch lernte um anerkannt zu werden und nun dement im Altenheim lebt.
"Jetzt, am Ende, verlor sie die so gründlich erarbeitete Zweitsprache wieder. Sie sprach nur noch die Sprache ihrer ersten Jahre.
Ihr Gedächtnis war fast abgetragen, Schicht für Schicht, bis hinunter zum Plusquamperfekt.
Darunter gab es keine Lage mehr, in der noch etwas gespeichert war.
Ihre Sprache war fast abgetragen. Unter dem Kindheitsdialekt lagen keine Sätze mehr, da lag nur noch Lallen, Keckern, Wimmern."
Auch seine Darstellungen der Vergangenheit sind vielleicht gerade wegen ihrer Knappheit prägnant und treffsicher und ich (aus dieser Zeit und Gegend stammend) habe Vieles wiedererkannt – leider. So bleibt am Ende ein zwiespältiges Leseerlebnis: keine herausragende Geschichte, aber eindringliche Bilder eines Lebens, das die Vergangenheit fast zerstört hätte.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für