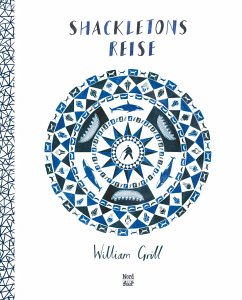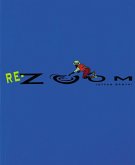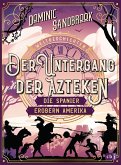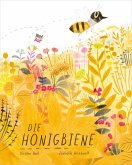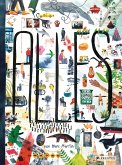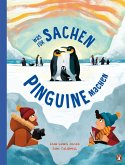In den letzten Tagen des Goldenen Zeitalters der Antarktisforschung, träumte der Polarforscher Ernest Shackleton davon, den antarktischen Kontinent von Küste zu Küste zu durchqueren. Als sein Schiff, die Endurance, im Packeis stecken blieb und sank, hätten Shackleton und sein Team ihr Abenteuer beinahe mit dem Leben bezahlt. Doch dank Shackletons wagemutiger Rettungsaktion überlebte das ganze Expeditionsteam unter widrigsten Umständen.
William Grill hat Shackletons gefährliche Reise beeindruckend illustriert.
William Grill hat Shackletons gefährliche Reise beeindruckend illustriert.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
William Grill erzählt in seinem Kinderbuch von der Expedition des Briten Ernest Shackleton, der mit seiner Mannschaft auf der Endurance zum Südpol aufbrach. Sehr anschaulich findet Rezensentin Eva-Christina Meier, wie Grill in Vignetten die Arbeiten der Mannschaft zeichnet, in großen Blau-Formaten das Packeis türmt, von dem die Endurance bald eingeschlossen sein wird, und wie sich schließlich die Expedition retten kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wo bleibt der Aufbruch ins Unbekannte? Ein Bilderbuch zeichnet Ernest Shackeletons Antarktisreise nach.
Shackleton? Es ist noch gar nicht lange her, da war der Polarforscher und Abenteurer Ernest Shackleton bestenfalls einigen Eisspezialisten bekannt. Zweimal war er zum Südpol aufgebrochen, einmal wollte er die Antarktis durchqueren und einmal sie mit dem Schiff umrunden - doch jede seiner Expeditionen zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts misslang.
Nie erreichte er sein Ziel, einmal verlor er sogar sein Schiff, die "Endurance", samt dem Großteil der Ausrüstung. Allerdings kam bei seinen abenteuerlichen Unternehmungen nie auch nur ein Mensch zu Schaden. Und man könnte glauben, dass Shackleton überhaupt erst im Moment der Krise über sich hinauswuchs. Er war kein kühler Stratege wie Amundsen. Und er war kein romantisch veranlagter Draufgänger und Egozentriker wie Scott. Was ihn zum Helden taugen ließ, war der übermenschlich zu nennende Einsatz, mit dem es ihm jedes Mal gelang, noch in den ausweglosesten Situationen das Leben der gesamten Mannschaft zu retten. Es paaren sich bei ihm Ruhe und Flexibilität mit einem "nimmermüden Optimismus sowie dem Geschick, diese Zuversicht an andere weiterzugeben", attestierte ihm Frank Wild, der stellvertretende Kommandant der "Endurance". Und er gab schon mal bei Eiseskälte seine Handschuhe an einen Matrosen ab. "Lieber ein lebendiger Esel als ein toter Löwe", wurde ihm als Bonmot in den Mund gelegt. Die Geschichte seiner "Endurance-Expedition" erreichte dabei geradezu mythische Dimensionen. Sie ist womöglich die größte Heldensage des zwanzigsten Jahrhunderts.
Dass sie zunächst vergessen ging, hatte einen einfachen Grund: Shackleton kehrte 1916 zurück, inmitten der Wirren des Ersten Weltkriegs, und die Menschen hatten andere Sorgen, als sich den Frostbeulen einer kleinen Gruppe von Eisverrückten anzunehmen und deren Erzählungen ihres Überlebenskampfes zu lauschen. Und auch die Wiederentdeckung lässt sich erklären: Ende der neunziger Jahre tauchten die verschollen geglaubten Glasnegative des Expeditionsfotografen Frank Hurley auf. Er hatte sie über alle Widrigkeiten der Flucht aus dem Eis und dem qualvollen Überwintern am Kiesstrand von Elephant Island retten können, an dem die Mannschaft monatelang in der antarktischen Kälte und Finsternis unter einem umgedrehten Rettungsboot hauste. Es sind sensationelle Bilder. Die Welt am Umbruch ins neue Jahrtausend hatte augenblicklich ihre Ikonenhaftigkeit erkannt: Sie wurden zu Symbolbildern für den Epochenwechsel. Nie lagen Aufbruch und Nullpunkt, Sehnsucht, Hoffnung und ein buchstäblich ballastfreier Neubeginn dichter beieinander als in dieser Kulisse des blanken Nichts.
Vor allem die Fotos des Schiffs, der "Endurance", die im Januar 1915, dem antarktischen Sommer, im Packeis des Wedellmeers stecken geblieben war und nicht wieder freikam, wurden tausendfach veröffentlicht. Darunter ein Bild wie aus dem Geiste Caspar David Friedrichs, dessen Gemälde der "Gescheiterten Hoffnung" gleichsam als Wasserzeichen durch die Schwarzweißfotografie schimmert. Aber es erzählte eben nicht nur vom Scheitern, sondern zugleich von einem Sieg. Und in dessen Fahrwasser sollte Ernest Shackleton gleichsam zum Führer in die neue Epoche werden. Es dauerte nicht lange, da nannte die Liste der Buchgroßhändler mehr als siebzig Bücher, die Shackletons Namen im Titel trugen. Biographien, Abenteuerbücher, Historienromane - sogar Ratgeber wie "Shackletons Führungskunst", die einem neuen Wirtschaftszweig in deren neuem unbekannten Raum helfen sollte, sich zurechtzufinden: im Cyberspace.
Und jetzt also ein Kinderbuch, das der Shackleton-Euphorie von damals fast eine Menschengeneration hinterherhinkt. Warum auch nicht? Im Gegenteil: Warum ist solch ein Buch nicht schon damals erschienen? Es gibt den charismatischen Helden. Und es gibt ein Abenteuer zu erzählen, das wie nach der Formel der klassischen Heldensage entworfen ist, nur dass die Aufgabe, die der Held sich sonst stellt, bevor er die Rückreise antritt, hier ebendiese Rückreise ist: das Nachhausekommen. William Grill, zu dessen Klienten neben der "Financial Times" und der "New York Times" auch Harrods gehört, hat "Shackletons Reise" gezeichnet und geschrieben. Grill ist trotz seines jungen Alters ein routinierter Illustrator mit einem leicht wiedererkennbarem Stil der dicken Schraffur ungespitzter Buntstifte sowie einer oft seltsam verzerrten Perspektive, die vor allem zu einer niedlichen Dickleibigkeit der Figuren führt.
Vielleicht hätte er es beim Zeichnen belassen sollen, denn es sind wunderbare Bilder, in denen man zwar mitunter die Vorlagen von Hurleys Fotografien noch erkennt, aber vor allem in den Motiven der schier unendlichen Weite des Eises findet Grill zu einem eigenen, einzigartigen Ausdruck. Verloren, winzig klein, schiebt sich da die "Endurance" durch ein Labyrinth der Eisschollen und hängt später, noch kleiner, im Packeis fest. Dann rudern die Männer mit den Rettungsbooten zwischen Eisbergen hindurch, und einer Nussschale gleich hüpft die "James Caird", ein Beiboot, mit dem sich Shackleton auf den dreizehnhundert Kilometer langen Weg nach Süd-Georgien machte, um Rettung zu holen, durch Wellenberge. Das sind Bilder, die man so schnell nicht vergisst, und in die sich nicht nur Kinder hineinträumen können.
Aber Grills Buch ist nicht getragen von der Shackleton-Euphorie, die seine Wiederentdeckung vor knapp zwanzig Jahren entfachte. Eher gleicht es einer Fleißarbeit aus dem Archiv. Mit geradezu buchhalterischem Eifer hakt William Grill die Expeditionsgeschichte Punkt für Punkt ab, als folge er stur dem Logbuch. Dabei entfaltet sein Text etwa die Spannung eines Wikipedia-Eintrags. Anfangs glaubt man noch, dem einen eigenen Reiz entziehen zu können, wenn Grill nicht nur jedes Mitglied der Mannschaft einzeln zeichnet und benennt, sondern auch sämtliche neunundsechzig Schlittenhunde der Expedition. Doch wenn es nach dem Schiffbruch etwa heißt "Der Zustand der Männer verschlechterte sich weiter", nimmt man es als Leser und Betrachter teilnahmslos, bestenfalls kopfnickend zur Kenntnis. Da ist mal von Wagnis die Rede, mal von Erschöpfung, mal von Dehydration - immer aber bleiben es bloß Vokabeln.
"Ich glaube, es entspricht unserem Wesen", zitiert Grill am Ende des Buchs Shackleton, "dass wir forschen und ins Unbekannte vordringen." Von genau diesem Geist hätte man sich etwas mehr gewünscht.
FREDDY LANGER
William Grill: "Shackletons Reise".
Aus dem Englischen von Harald Stadler. NordSüd Verlag, Zürich 2015. 78 S., geb., 19,99 [Euro]. Ab 8 J.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main