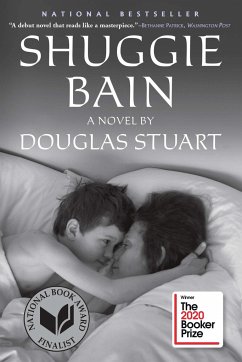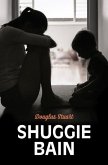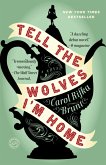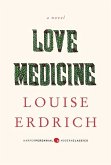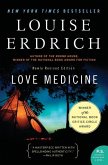Böse feixen die Kinder: Douglas Stuarts preisgekrönter Roman "Shuggie Bain" verliert die literarische Ästhetik aus dem Blick
Die Szene könnte ans Herz gehen. Wie der ganze Roman spielt sie in der Trostlosigkeit eines Arbeiter- oder vielmehr Arbeitslosenviertels im Glasgow der Achtzigerjahre, mitten in der Thatcher-Ära. Der siebenjährige Shuggie, gepeinigt von seinen Mitschülern, weil er lieber mit seiner Puppe als mit dem Fußball spielt, flüchtet sich hinter ein Wirtshaus. Dort entdeckt er zwischen Bierlachen eine benzinverschmutzte Pfütze, auf der "bunte Regenbögen" schimmern. Was treibt nun der Junge? "Shuggie kniete sich hin und tauchte Daphnes blondes Haar" - Daphne ist der Name seiner Puppe - "in die schillernde Pfütze." Aber: "Als er sie wieder herauszog, hatte ihr glänzendes gelbes Haar die Farbe der Nacht, und er schnalzte mit der Zunge. Wo waren die schönen Regenbogenfarben jetzt?" Der Junge, die Puppe, die Regenbogenfarben, umgeben von einer feindlichen Umwelt, die alle Schönheit und jede Hoffnung zunichtemacht: Angesichts dieser leider allzu dick aufgetragenen Schlüsselszene stellt sich die Frage, ob der Roman trotz oder gerade ihretwegen im letzten Jahr mit dem Booker-Preis ausgezeichnet worden ist.
Zu vermuten ist jedenfalls, dass vordringlich moralische Gründe für die Juroren ausschlaggebend waren. "Shuggie Bain" erzählt von einem zarten, sensiblen Jungen in einer chauvinistischen, von Armut, Gewalt und Alkohol geprägten Wirklichkeit. Das gibt Lesern zwar die Möglichkeit zur Identifikation: "Shuggie - ach, Shuggie!", mit diesem Gefühlsausruf des Kritikers und Schriftstellers Daniel Schreiber bewirbt der Hanser Verlag den Roman nicht ohne Grund. Literarisch reizvoll ist diese Gegensatzwelt aber deswegen noch lange nicht. Wie ermahnt der grobschlächtige, kaltherzige Sportlehrer jenen Schüler, der Shuggie soeben mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat? Natürlich mit den Worten: "Du sollst keine Mädchen schlagen!" Und selbstverständlich bricht daraufhin die ganze Klasse "in Gelächter aus". Über das gedankliche und darstellerische Niveau eines mittelguten Jugendromans reicht "Shuggie Bain" in solchen Passagen nicht hinaus.
Aber auch dort, wo Stuart ganz bewusst Zitate in seinen Roman einfügt, ergibt sich daraus kaum erzählerischer Mehrwert. Tanzend im Wohnzimmer, dabei "schrille, feminine" Schreie ausstoßend, bemerkt Shuggie, dass ihn einige Kinder aus der Nachbarschaft durchs Fenster beobachten. Sie feixen böse. In diesem Moment tritt die Mutter ins Zimmer, und es entspannt sich ein charakteristischer Dialog: "Wenn ich du wäre, würde ich weitermachen." - "Ich kann nicht." - "Du weißt, dass sie nur gewinnen, wenn du sie gewinnen lässt." - "Ich kann nicht." - "Gib ihnen die Genugtuung nicht." - "Mammy, hilf mir. Ich kann nicht." - "Doch. Du. Kannst." Und schließlich: "Kopf hoch, und gib Gas." Dann heißt es: "Im ersten Moment war es schwer, wieder in Bewegung zu kommen, die Musik zu spüren, zu dem anderen Ort im Kopf zurückzufinden, wo er Selbstbewusstsein hatte. Aber es steckte einfach in ihm, und als es aus ihm herausbrach, stellte er fest, dass er es nicht aufhalten konnte."
Der Verweis auf Stephen Daldrys Kinoerfolg "Billy Elliot - I Will Dance" und die überkuratiert wirkende Dialogführung sind das eine. Das andere ist das ominöse "Es", von dem am Ende der Passage die Rede ist: Es steckte in ihm, er konnte es nicht aufhalten, es brach aus ihm heraus. Wovon ist die Rede? Wohl doch vom triebhaften "Es" im Sinne Freuds, das sich in der geschilderten Szene gegen die Kontrolle durch das rationalistische "Ich" zur Wehr setzt und schließlich heldenhaft siegt. Feinfühlig geht anders, zumal das Reflektierte des Vorgangs ("er stellte fest, dass er es nicht aufhalten konnte") wohl eher der Wahrnehmung eines Erwachsenen als der eines Kindes entspricht.
Und doch macht die Tanzszene eines unmissverständlich klar: dass Shuggie ohne seine Mutter Agnes verloren wäre. Sie lebt ihm vor, wie man wieder aufsteht: "Wenn sie sich im Suff blamiert hatte, war sie am nächsten Tag aufgestanden, hatte ihren besten Mantel angezogen und war der Welt entgegengetreten." Was für den Sohn gilt, gilt aber auch für den Roman, weil einzig Agnes ihm einen sporadischen Plot verleiht: Über Hunderte von Seiten hinweg beobachtet man sie dabei, wie sie auf schmalem Grat mit ihrem Leben klarzukommen versucht.
Die Position, in die man als Leser dadurch gebracht wird, ist unangenehm: Wie lange hält Agnes dieses traurige, erbärmliche Leben, das ein ständiger Wechsel von Agonie, Exzess und Gewalt ist, noch durch? Wann wird sie endgültig stürzen? Der Leser wird so in die Rolle eines Voyeurs gebracht, der zwar mitfühlend, aber mit unaufhebbarer Distanz auf Agnes, ihren Sohn und das sie umgebende Milieu hinunterblickt. Stuart will ganz sicher auf das Gegenteil hinaus, nämlich die gesellschaftliche Empathie befördern, aber es ist die Konstruktion seines Romans, die eine klassistische Lektürehaltung provoziert. Das Buch ist ein Feel-Good Read für die Mittelklasse.
Erzählerisch reflektiert wird dieser bedenkliche Sozialrealismus an keiner Stelle. In der deutschen Übersetzung kommt allerdings, und ebenfalls unbeabsichtigt, eine Brechung ins Spiel, nämlich durch die sozio- und dialektische Figurenrede: "'Schulding Sie?', sagte er aus den Gedanken gerissen. 'Ich habse durche Scheibe nich gehört.'"
Die Übersetzerin Sophie Zeitz lässt ein leicht affektiertes Hochdeutsch auf eine Mischung aus schnoddrigem Berlinerisch, kolloquialem Nord- und proletarischem Ruhrpottdeutsch treffen. Die Grenzen der Übersetzbarkeit treten an solchen Stellen deutlich zutage, was aber gerade vorteilhaft ist, weil dadurch Stuarts auf Identifikation zielender Realismus beständig unterlaufen wird. Tatsächlich nimmt die Übersetzung dem englischsprachigen Original nichts, sondern erweitert es um eine wichtige Reflexionsebene.
"Shuggie Bain" ist Douglas Stuarts Debütroman, der Mann hat bereits eine Karriere als Modedesigner hinter sich, was sicher auch erklärt, warum er ein so starkes, noch kleinste Details berücksichtigendes Augenmerk auf Agnes' Kleidung und überhaupt auf ihr Äußeres legt. Das ist nachvollziehbar und auch überzeugend, denn hiervon hängt ja nichts Geringeres als ihr Selbsterhalt ab und die Bewunderung durch ihren Sohn. Dem Roman liegt ein emphatischer Modebegriff zugrunde. Kaum Interesse zeigt Stuart hingegen an Aspekten der literarischen Form. Sein Roman erliegt damit ebenjenem Irrtum, den der Literaturwissenschaftler Moritz Baßler in seinem viel diskutierten Essay über den "Neuen Midcult" in der Gegenwartsliteratur beschrieben hat; dem Irrtum nämlich, "dass Leiden und Probleme, wie relevant auch immer, ohne formale Durcharbeitung identifikatorisch mit Kunstanspruch dargeboten, zu etwas anderem führen würden als - Kitsch".
Nun geht es überhaupt nicht darum, Romanen wie "Shuggie Bain" ihre Daseinsberechtigung abzusprechen, im Gegenteil, es stimmt wohl, dass solche Geschichten und Erfahrungen in der Vergangenheit zu selten erzählt worden sind. Aus dieser Sicht ist das Buch nur zu begrüßen. Zu Missverständnissen sollte es aber nicht kommen: Wer einen solchen Roman zu den herausragendsten Leistungen der Gegenwartsliteratur zählt, der hat die Frage nach der literarischen Ästhetik, nach der Angemessenheit des literarischen Ausdrucks im Verhältnis zum erzählten Inhalt, stillschweigend als irrelevant abgetan. Eine Verarmung dessen, wozu Literatur in der Lage ist, bedeutet dies ohne Frage. KAI SINA
Douglas Stuart: "Shuggie Bain". Roman.
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz. Hanser Berlin Verlag, Berlin 2021. 496 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
A heartbreaking novel, a book both beautiful and brutal . . . All that grief and sadness and misery has been turned into something tough, tender and beautifully sad. The Times