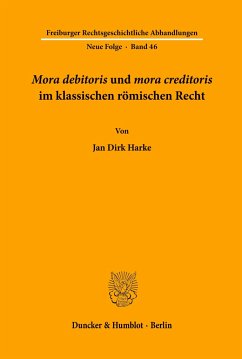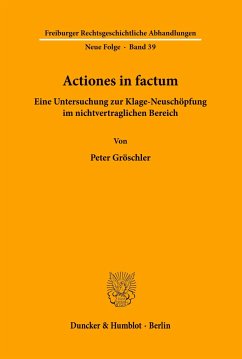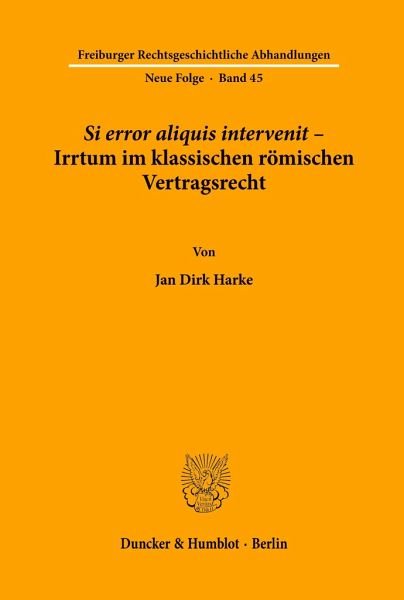
Si error aliquis intervenit - Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht.
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
79,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Woran scheiterte im klassischen römischen Recht ein irrtumsbehafteter Vertrag: an der fehlenden Bestimmung seines Gegenstands oder am Mangel der Übereinstimmung im Willen? Vorgeprägt durch die moderne Vorstellung des Vertrags als einer Summe von Willenserklärungen, neigt man dazu, die fehlende Willensübereinkunft für ausschlaggebend zu halten. Sie bleibt übrig, wenn man die heutige willenstheoretische Konstruktion des Vertrags um den Erklärungsfaktor bereinigt. Ist es aber wirklich denkbar, daß man in Rom der Äußerung der Parteien keine Bedeutung beigemessen hat? In den Gutachten der klassischen Juristen finden wir zwar keine Spuren einer Theorie der Willenserklärung. Dies bedeutet freilich noch nicht, daß auch der objektive Vertragsinhalt als gemeinsame Äußerung der Parteien ohne weiteres aus Rücksicht auf deren innere Einstellung übergangen worden wäre. Daß die römischen Juristen dem äußeren Hergang eines Vertrages einen Eigenwert beigemessen haben, kommt gerade in der für uns so fremdartig wirkenden Gleichsetzung von Irrtum und Dissens zum Ausdruck: Wer sich auf dissensus berief und geltend machte, daß es am nötigen Konsens für die Vertragsbindung fehlte, mußte behaupten und beweisen können, daß er einem Irrtum unterlegen war. Dessen Gegenstand war der Vertragsinhalt, wie er sich aus dem objektiven Erscheindungsbild der Vereinbarung ergab und die Vermutung des consensus für sich hatte. Nicht dieser war gesondert geprüfte Voraussetzung der Vertragsgeltung, der Irrtum vielmehr ein Einwand, mit dem sich ein Vertragspartner auf die Diskrepanz von objektivem Geschäftsinhalt und Parteivorstellung berief. Eine Überschneidung mit dem Recht der Leistungsstörungen war dabei ebenso ausgeschlossen wie die Vermischung von Irrtumsrecht und Auslegung.