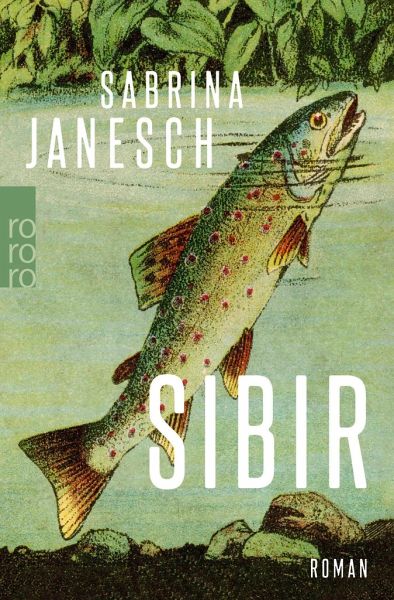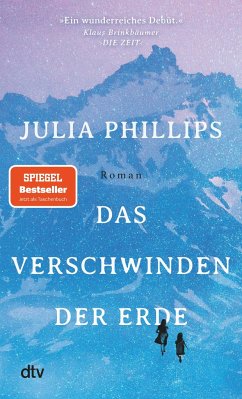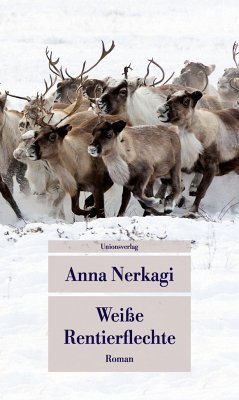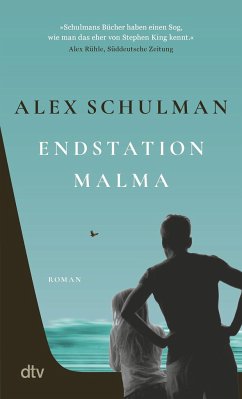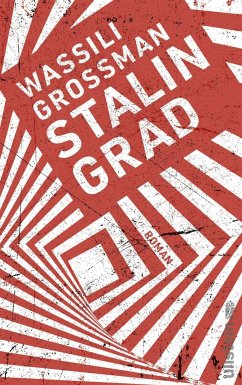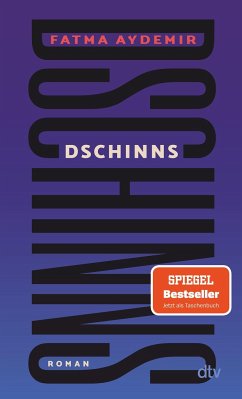Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Sibirien. Für den zehnjährigen Josef Ambacher ein furchterregendes Wort, das die Erwachsenen für den fernen, fremden Osten verwenden. Dorthin werden 1945 Hunderttausende deutscher Zivilisten von der Sowjetarmee verschleppt. Als dieses Schicksal auch Josef trifft, findet er sich im fernen Kasachstan in einer harten, aber auch wundersamen, mythenvollen Welt wieder. Und er lernt, sich gegen die Steppe und ihre Vorspiegelungen zu behaupten.45 Jahre später lebt Josef im niedersächsischen Mühlheide und ist Vater einer Tochter. Doch auch hier wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als n...
Sibirien. Für den zehnjährigen Josef Ambacher ein furchterregendes Wort, das die Erwachsenen für den fernen, fremden Osten verwenden. Dorthin werden 1945 Hunderttausende deutscher Zivilisten von der Sowjetarmee verschleppt. Als dieses Schicksal auch Josef trifft, findet er sich im fernen Kasachstan in einer harten, aber auch wundersamen, mythenvollen Welt wieder. Und er lernt, sich gegen die Steppe und ihre Vorspiegelungen zu behaupten.
45 Jahre später lebt Josef im niedersächsischen Mühlheide und ist Vater einer Tochter. Doch auch hier wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Woge von Aussiedlern die niedersächsische Kleinstadt erreicht. Nun steht seine Tochter Leila zwischen den Welten und muss vermitteln - zu einem Zeitpunkt, an dem sie selbst erst beginnt, den Spuk der Geschichte zu begreifen.
45 Jahre später lebt Josef im niedersächsischen Mühlheide und ist Vater einer Tochter. Doch auch hier wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Woge von Aussiedlern die niedersächsische Kleinstadt erreicht. Nun steht seine Tochter Leila zwischen den Welten und muss vermitteln - zu einem Zeitpunkt, an dem sie selbst erst beginnt, den Spuk der Geschichte zu begreifen.
Sabrina Janesch wurde 1985 in Niedersachsen geboren. Sie ist die Tochter einer polnischen Mutter und eines Vaters, der als Kind nach Zentralasien verschleppt wurde. Für ihre Romane erhielt Janesch zahlreiche Preise; 'Die goldene Stadt' (2017) wurde zum Bestseller. Für die Recherche zu 'Sibir' sprach sie mit Zeitzeugen, las Tagebücher, historische Dokumente. Ihre Reise führte sie schließlich bis in das kasachische Steppendorf, in dem ihr Vater seine Kindheit verlebt hat. Sabrina Janesch lebt mit ihrer Familie in Münster.
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt TB.
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 349
- Erscheinungstermin: 16. Juli 2024
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 125mm x 27mm
- Gewicht: 302g
- ISBN-13: 9783499008870
- ISBN-10: 3499008874
- Artikelnr.: 70249148
Herstellerkennzeichnung
Rowohlt Taschenbuch
Kirchenallee 19
20099 Hamburg
produktsicherheit@rowohlt.de
Ein brillant komponiertes, einfühlsames Buch über ein wenig beleuchtetes Kapitel der deutsch-russischen Geschichte. NDR Kultur
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensentin Katharina Granzin genießt den eigenwilligen Zauber, der in Sabrina Janeschs Roman scheinbar "absichtslos" entstehe. Er erzählt, eingebettet in eine Rahmenhandlung aus Perspektive der erwachsenen Leila, von deren Kindheit Anfang der neunziger Jahre in einem Dorf am Rande der Lüneburger Heide, und in einem zweiten Strang von der Kindheit ihres Vaters, der im Zuge der Deportation deutscher Zivilisten in die Sowjetunion zu Ende des Zweiten Weltkriegs in der kasachischen Steppe aufwuchs. Wie es dabei in Leilas Kindheitserinnerung an ein manisches Bauen von Unterkünften mit Essensvorräten und Revolvern um ein von den Eltern weitervererbtes "Gefühl der Unbehaustheit" geht, und wie in der Erzählung der Kindheit des Vaters trotz traumatischer Ereignisse wie dem Verlust von Bruder und Mutter sich ein gewisser Dingzauber, die magische Aufladung von Gegenständen, über das Erzählte legt, findet die Kritikerin einnehmend. Von magischem Realismus möchte sie nicht sprechen, lieber von einem Roman wie ein "fantasievolles Kinderspiel", das Leichtigkeit und Schwere miteinander vereint.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Gebundenes Buch
Thematisch hat mir das Buch sehr gut gefallen. Die Autorin beschreibt in ihrem Roman ein eher unbekanntes Kapitel der deutsch-russischen Geschichte. 1945 werden hunderttausend Deutsche Zivilisten nach Kasachstan verschleppt von der Sowjetarmee.
In der Geschichte beschreibt die Autorin zwei …
Mehr
Thematisch hat mir das Buch sehr gut gefallen. Die Autorin beschreibt in ihrem Roman ein eher unbekanntes Kapitel der deutsch-russischen Geschichte. 1945 werden hunderttausend Deutsche Zivilisten nach Kasachstan verschleppt von der Sowjetarmee.
In der Geschichte beschreibt die Autorin zwei Kindheiten, einmal in Zentralasien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und einmal fünfzig Jahre später in Norddeutschland. Leider haben genau diese Zeitsprünge es mir sehr erschwert, einen Lesefluss zu finden, sodass ich leider kaum in die Story reingekommen bin. Wäre die Thematik nicht so spannend gewesen, hätte ich das Buch vermutlich abgebrochen.
Ich fand insgesamt die Erzählweise eher schwer und schleppend, sodass ich keinen wirklichen Zugang zum Buch finden konnte.
Schade!
Thematisch hat mir das Buch sehr gut gefallen. Die Autorin beschreibt in ihrem Roman ein eher unbekanntes Kapitel der deutsch-russischen Geschichte. 1945 werden hunderttausend Deutsche Zivilisten nach Kasachstan verschleppt von der Sowjetarmee.
In der Geschichte beschreibt die Autorin zwei Kindheiten, einmal in Zentralasien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und einmal fünfzig Jahre später in Norddeutschland. Leider haben genau diese Zeitsprünge es mir sehr erschwert, einen Lesefluss zu finden, sodass ich leider kaum in die Story reingekommen bin. Wäre die Thematik nicht so spannend gewesen, hätte ich das Buch vermutlich abgebrochen.
Ich fand insgesamt die Erzählweise eher schwer und schleppend, sodass ich keinen wirklichen Zugang zum Buch finden konnte.
Schade!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Geschichte wird lebendig;
Es gibt zwei Erzählzeiten im Buch, die sich immer wieder abwechseln und in ihren jeweiligen Entwicklungen gekonnt zueinander passen. Die Tochter Leila erinnert sich an ihre Familiengeschichte und Jugend und den Zuzug von deutschstämmigen Aussiedlen in den 1990er …
Mehr
Geschichte wird lebendig;
Es gibt zwei Erzählzeiten im Buch, die sich immer wieder abwechseln und in ihren jeweiligen Entwicklungen gekonnt zueinander passen. Die Tochter Leila erinnert sich an ihre Familiengeschichte und Jugend und den Zuzug von deutschstämmigen Aussiedlen in den 1990er Jahren und ihr Vater Josef an seine Verschleppung und zehnjährigen Aufenthalt in der siibirischen Steppe von 1945 bis 1955. Bisher wußte ich nicht viel über deutschstämmige Aussiedler, Verschleppte, Zivilgefangene in der Sowjetunion, aber hier wird die Geschichte anhand einer Familiengeschichte lebendig und greifbar. Sehr eindrücklich wird geschildert, wie dies das Leben und die Charaktere der betroffenen Familien über Generation prägt und Schuldgefühle hinterlässt, weil das Überleben unter widrigen Umständen gelungen ist. Der Schreibstil hat mir gut gefallen, er ist abwechslungsreich und lässt sich sehr angenehm und flüssig lesen. Ein wirklich lesenswertes Buch, dass ein Stück Geschichte lebendig macht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Sabrina Janesch entführt ihren Leser in eine Welt, die in Geschichtsbüchern eher marginal auftaucht und deren letzte Zeitzeugen allmählich aussterben. Sie stellt uns das Schicksal der deutschen Familie Ambacher vor, die vor Generationen in das Warteland eingewandert war und von dort …
Mehr
Sabrina Janesch entführt ihren Leser in eine Welt, die in Geschichtsbüchern eher marginal auftaucht und deren letzte Zeitzeugen allmählich aussterben. Sie stellt uns das Schicksal der deutschen Familie Ambacher vor, die vor Generationen in das Warteland eingewandert war und von dort im II. Weltkrieg nach Sibirien verschleppt wurde – als Zivilgefangene, wie so viele andere deutschstämmige Familien auch. Janesch erzählt von der Verschleppung, dem Leben in Kasachstan und der Rückkehr nach Deutschland in ein Land, das den Rückkehrern fremd geworden ist.
Die Autorin verteilt die Handlung auf zwei Zeitebenen und auf zwei Protagonisten, beides Kinder: einmal das Kind Josef, aus dessen Perspektive die Zeit in der kasachischen Steppe erzählt wird, und in der Jetztzeit ist es Josefs Tochter Leila, aus deren Sicht wir die Situation der Rückkehrer erleben.
Die Art und Weise, wie die Autorin diese beiden Ebenen miteinander verbindet, ist bestechend flüssig und geschmeidig. Assoziativ reiht sie die Erlebnisse der beiden Kinder aneinander; ob es ein Sturm in der Steppe ist, der Schamane bzw. die Tante als Heilerin, der Wintereinbruch, der Schulbesuch – die Zeitebenen verzahnen sich bewundernswert leicht ineinander.
Dadurch wird deutlich, welche Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen bestehen. Beide leiden unter dem Trauma der Entwurzelung, beide fühlen sich fremd und ausgegrenzt, beide suchen letztlich nach ihrer Identität.
In der Gegenwart kommt noch eine Facette hinzu. Was zunächst wie ein unmotivierter Kinderstreich aussieht – der Diebstahl von Zahngold -, entpuppt sich als Hinweis auf diejenigen, die für die Verschleppung und die Traumatisierung vieler Menschen verantwortlich waren: die Nationalsozialisten, deren Täter nach wie vor ungestraft unter uns leben. Hier schafft die Autorin mit Pawel eine wirklich beeindruckende Figur.
Der Teil, der in der Steppe spielt, hat mir wesentlich besser gefallen. Hier gelingen der Autorin einfach schöne Bilder wie z. B. das Kind Josef, das heimlich Wörter aus dem verbotenen Deutsch sammelt und aufbewahrt, um seine Identität und auch die Verbindung mit seiner toten Mutter zu bewahren. Sie vermeidet auch jede Schwarz-Weiß-Zeichnung der Figuren, und damit gelingen ihr mit wenigen Federstrichen Bilder von menschlicher Solidarität über ethnische Grenzen hinweg, aber auch Verrat und Eigennutz.
Der Jetzt-Teil gerät mir teilweise zu larmoyant. Die ständigen Klagen über die „schwere Kindheit“ und die grobe Ausgrenzung der Rückkehrerkinder – z. B. getrennte Sitzplätze in der Schule – wirken zu dramatisch. Zudem decken sie sich nicht mit meinen eigenen Wahrnehmungen.
Das Hörbuch wird eingelesen von Julia Nachtmann: perfekt, ein großer Hör-Genuss!
Insgesamt ein überzeugendes Buch, intelligent konstruiert.
Lese- und Hör-Empfehlung!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In "Sibir" verbindet Sabrina Janesch zwei Coming-of-Age-Geschichten: die von Leila und die ihres Vaters Josef. Josef wird als Kind nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie in die kasachische Steppe verschleppt. Das Leben unter extremen Bedingungen, das Miteinander verschiedener …
Mehr
In "Sibir" verbindet Sabrina Janesch zwei Coming-of-Age-Geschichten: die von Leila und die ihres Vaters Josef. Josef wird als Kind nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie in die kasachische Steppe verschleppt. Das Leben unter extremen Bedingungen, das Miteinander verschiedener Volksgruppen, eine gewisse kasachische Mystik - das war eine interessante Mischung und eine Lebensrealität, von der ich vorher noch nicht gelesen hatte und die ich sehr spannend fand. Josefs Tochter Leila wächst in Norddeutschland unter Russlanddeutschen auf. Auch dies eine Lebensrealität von der ich nichts weiß - geprägt von mehreren Kulturen, der Vergangenheit und der Suche nach Heimat. Interessant und anders bei diesem Coming-of-Age-Buch der ständige Bezug auf die Vergangenheit. Das Umfeld beider Kinder/Jugendlicher ist stets geprägt vom Blick zurück ihres Umfelds, während junge Menschen doch eigentlich nach vorne blicken. So müssen beide ihren Weg mit und abseits dieser Prägung finden. Während ich Leilas Geschichte irgendwann mehr als auserzählt fand, hätte ich gerne noch mehr von Josef und dem Dorf Nowa Karlowka gelesen - wie so oft bei Geschichten auf zwei Zeitebenen kann auch hier die Geschichte in neuerer Zeit nicht mit der älteren mithalten.
Insgesamt sind es zwei eher ruhige Geschichten mit einem überschaubaren Handlungsbogen. Es zählt eher die Atmosphäre und das hat Sabrina Janesch wieder einmal gut hinbekommen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Sibir (russisch) Sibirien (deutsch). So werden vereinfachend alle Gebiete hinter dem Ural bezeichnet. Dorthin wird Josef Ambacher 1945 von der Sowjetarmee mit seiner Familie verschleppt. Als sie in der weiten Steppe von Kasachstan ankommen, haben es viele nicht geschafft. Aber Josef wird …
Mehr
Sibir (russisch) Sibirien (deutsch). So werden vereinfachend alle Gebiete hinter dem Ural bezeichnet. Dorthin wird Josef Ambacher 1945 von der Sowjetarmee mit seiner Familie verschleppt. Als sie in der weiten Steppe von Kasachstan ankommen, haben es viele nicht geschafft. Aber Josef wird überleben und irgendwann nach West-Deutschland ausreisen können. Und fortan mit den Dschinn der Steppe kämpfen. Seine Tochter Leila wird in Friedenszeiten und relativem Wohlstand in der Lüneburger Heide aufwachsen. Doch auch sie wird geprägt von den Erinnerungen der Familie und vom Gefühl des "Nicht-Dazu-Gehörens".
" (...) einen Zusammenhang herzustellen (...) all jener, die mit uns am Stadtrand wohnten. Der Begriff RAND kennzeichnete gut unsere Gemeinschaft (...) ich und die anderen Kinder aus unserer Siedlung saßen nie, nie in der Mitte der Klasse, sondern stets an der Seite, ein wenig abgerückt (...). Instinktiv spürten wir, dass unsere Eltern von denjenigen in der Mitte der Gesellschaft kritisch beäugt wurden, belächelt oder schlicht nicht beachtet" (S.15f)
Eine neue Dynamik erhält dieses Gefühl 1990, als nach dem Fall der Mauer neue Aussiedler ankommen und der Vater sich erneut mit seiner Vergangenheit konfrontiert sieht, die er eigentlich verdrängen und vergessen wollte.
Eigentlich spielt der Roman abwechselnd in den Jahren 1945 und 1990 und erzählt die Geschichte des Vaters und seiner Tochter abwechselnd. Durch geschickt eingestreute Anmerkungen werden aber auch Zusammenhänge dargestellt und die gesamte Geschichte deutlich und verständlich. Und wenn auch viele Geschehnisse tragisch sind, so durchzieht das Buch doch eine große Wärme und Menschlichkeit und eine große Liebe zu den Menschen, die von historischen Ereignissen durch die Welt gewirbelt werden und alle ihre Kraft aufbringen müssen, um zu überleben. Das geht nicht ohne Wunden ab. Die Autorin ist mir schon mit ihrem ersten Roman "Katzenberge" positiv aufgefallen, dort erzählt sie ebenfalls eine Familiengeschichte von Flucht und Vertreibung, von ewiger Heimatlosigkeit, Entwurzelung und dem Gefühl eines ständigen Provisoriums. Diese Geschichte geht in die gleiche Richtung und ist ebenfalls von der eigenen Familiengeschichte der Autorin inspiriert.
Beeindruckend ist die herausragende, bildhafte und gut verständliche Sprache des Romans, die eine einzigartige Stimmung mit sich bringt. Voller Ruhe und Wärme, trotz aller schlimmen Ereignisse. Denn immer wieder gibt es einen Sonnenstrahl im Elend, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit. Die Lektüre tut daher irgendwie gut. Zusätzlich werden wichtige historische Ereignisse erzählt, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Daher: Eine ganz große Lesempfehlung!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ergreifend und authentisch
Dies ist die Geschichte von Joseph Ambacher, der 1945 als zehnjähriges Kind zusammen mit seiner Familie aus dem Egerland nach Sibirien verschleppt wird und zehn Jahre lang in der kasachischen Steppe lebt. Es ist auch die Geschichte seiner Tochter, die in den 1990er …
Mehr
Ergreifend und authentisch
Dies ist die Geschichte von Joseph Ambacher, der 1945 als zehnjähriges Kind zusammen mit seiner Familie aus dem Egerland nach Sibirien verschleppt wird und zehn Jahre lang in der kasachischen Steppe lebt. Es ist auch die Geschichte seiner Tochter, die in den 1990er Jahren in einer Kleinstadt in der Lüneburger Heide aufwächst und auf Identitätssuche ist: Die Verschleppung und das Trauma ihrer Familie ist ihr bekannt; sie lebt in einem Viertel 'am Rande' der Stadt umgeben von anderen Aussiedlern mit ähnlicher Geschichte. Dabei versucht sie ihren Vater zu verstehen und eine Brücke zu den "Normalos" zu finden. Die Ordnung der Dinge und die mühsam erarbeiteten Identitäten geraten ins Wanken, als 1990 weitere Aussiedler aus Russland nach Deutschland kommen und ihren Platz zu finden versuchen. Für Joseph Ambacher verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen seinen Lebenswelten, die Stimmen der kasachischen Steppe holen ihn ein.
Sabrina Janesch erzählt sehr einfühlsam und sehr gekonnt bzw. sehr wissend vom Schicksal der im Zweiten Weltkrieg nach Sibirien verschleppten Deutschen, vom Überleben, von der Erinnerung, der Zerrissenheit und vom Trauma. Ihr Text ist sehr authentisch und wer Ähnliches aus seiner Biografie kennt, der wird von diesem Buch sehr ergriffen sein. Es hat zwischendrin ein paar Längen, insgesamt aber eine klare Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Josef ist zehn Jahre alt, als er mit seiner Familie am Kriegsende aus dem Warthegau nach Sibirien verschleppt wird. Dort wartet noch nicht einmal ein Heim auf die Familie Ambacher - sie müssen selbst sehen, wo sie unterkommen und wie sie sich arrangieren - und irgendwie gelingt es ihnen …
Mehr
Josef ist zehn Jahre alt, als er mit seiner Familie am Kriegsende aus dem Warthegau nach Sibirien verschleppt wird. Dort wartet noch nicht einmal ein Heim auf die Familie Ambacher - sie müssen selbst sehen, wo sie unterkommen und wie sie sich arrangieren - und irgendwie gelingt es ihnen tatsächlich, sich einzuleben und mit der kasachischen Bevölkerung überraschend gut zu arrangieren.
"Nur" zehn Jahre müssen sie dort verbringen und werden dann zuruck nach Deutschland, diesmal in ein niedersächsisches Dorf gebracht - aus dem Leila, die Tochter des inzwischen längst erwachsenen Josef und seiner polnischen Frau, berichtet.
Diese Ereignisse haben mich sehr berührt, denn auch meine Familie musste sich nach dem Krieg in einem neuen Umfeld arrangieren und konnte nicht immer selbst entscheiden, wenn es für sie auch nicht nach Sibirien ging. Aus Josef hat sich ein Eigenbrötler mit starkem Helfersyndrom entwickelt, der es weder Frau noch Tochter leicht macht mit seinen häufigen spontanen Entscheidungen. Vor allem, als nun wieder Spätaussiedler aus Kasachstan eintreffen und er sich wie selbstverständlich um sie kümmert. Schmerz, Schuld und Verlust - das sind immer wiederkehrende Empfindungen und damit auch Grundlagen zum Handeln - nicht nur bei ihm.
Ich habe bisher zwei Romane von Sabrina Janesch gelesen und habe ihren sehr eigenen, skurrilen, durchaus auch geheimnisvollen und immer mutigen, da keinem Trend folgenden Stil sehr genossen. Diesmal etwas weniger - es blieb mir dann doch insgesamt zu viel im Nebulösen - nicht nur Emma, Josefs Mutter, die im sibirisch-kasachischen Dunst verschwindet und nie wieder auftaucht.
Auch hier schreibt sie warmherzig und originell, doch bleibt vieles im Diffusen, im Unklaren - ein wenig kommt es mir vor, als ob ich einen zweiten Band eines Werkes lese, ohne den ersten zu kennen. Vieles wird nicht nicht vorbereitet, ich fühlte mich als Leserin oft vor vollendete Tatsachen gestellt.
Sabrina Janesch kann nichts Schlechtes schreiben - dennoch, ich durfte sie schon deutlich stärker in Form erleben bzw. -lesen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
"Sibir" von Sabrina Janesch ist ein faszinierender historischer Roman, der auf einer wahren Geschichte basiert und die Reise einer Gruppe deutscher Auswanderer in die unwirtliche Wildnis Sibiriens während der Stalin-Ära erzählt. Janesch hat offensichtlich intensiv …
Mehr
"Sibir" von Sabrina Janesch ist ein faszinierender historischer Roman, der auf einer wahren Geschichte basiert und die Reise einer Gruppe deutscher Auswanderer in die unwirtliche Wildnis Sibiriens während der Stalin-Ära erzählt. Janesch hat offensichtlich intensiv recherchiert, um die historischen Ereignisse und Umstände dieser Zeit genau darzustellen, und sie schafft es, die Leser:innen mit der Geschichte und dem Schicksal ihrer Charaktere zu fesseln.
Besonders beeindruckend ist die Sprache, die Janesch benutzt. Sie ist poetisch, aber dennoch klar und präzise, und sie verleiht den Beschreibungen der Landschaft und der Charaktere eine außergewöhnliche Tiefe und Schönheit. Die Leser:innen werden mit in die eisige Wildnis genommen und können die harten Lebensbedingungen der Auswanderer hautnah miterleben. Doch auch die zwischenmenschlichen, zarten Seiten werden subtil beleuchtet.
Insgesamt ist "Sibir" ein bewegendes Buch, das nicht nur historisch genau ist, sondern auch eine berührende Geschichte erzählt. Janesch versteht es, historische Ereignisse mit fiktiven Charakteren zu verweben, um ein mitreißendes Werk zu schaffen, das den Leser:innen noch lange im Gedächtnis bleibt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Sibir oder wie wir es kennen, Sibirien, war lange die Heimat von Josef Ambacher, der als Kind mit seiner Familie dorthin verschleppt wurde. 10 Jahre hat er dort verbracht bevor er wieder zurück nach Deutschland durfte.
Dort lebt er mit Frau und Tochter und fühlt sich trotzdem immer …
Mehr
Sibir oder wie wir es kennen, Sibirien, war lange die Heimat von Josef Ambacher, der als Kind mit seiner Familie dorthin verschleppt wurde. 10 Jahre hat er dort verbracht bevor er wieder zurück nach Deutschland durfte.
Dort lebt er mit Frau und Tochter und fühlt sich trotzdem immer irgendwie fremd. Als in den 90ern die Spätaussiedler aus Russland in seinem Ort ankommen, holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Seine Tochter Leila hilft ihm das zu bewältigen und erzählt dabei die Geschichte.
Die Autorin verknüpft in ihrem Buch die Kindheit Josefs in Sibirien und die seiner Tochter Leila in Deutschland. Was haben die beiden erlebt, was verbindet die doch so unterschiedlichen Kindheiten?
Dabei springen wir immer in der Zeit hin und her. Dieses stört mich an Büchern normalerweise nicht. Hier allerdings war der Sprung oft mitten im Kapitel und mehr als einmal musste ich überlegen wo wir uns jetzt befinden. Das hat mich beim Lesen leider sehr gestört. Ich hätte es besser gefunden wenn jede Zeit ihr eigenes Kapitel bekommen hätte. vielleicht auch mit Jahresdaten.
Auch hätte ich gerne mehr über Josefs Kindheit in Sibirien erfahren. Das was wir erfahren war zwar gut recherchiert und real beschrieben, ebenso ausdrucksstark und empathisch beschrieben, aber eher kurz gehalten. Ich denke das hätte man viel ausführlicher schreiben können. Mir blieben auch viele Fragen offen, die ich gerne beantwortet bekommen hätte.
Die Kindheit von Leila wird dann aber für mich stellenweise etwas zu ausführlich beschrieben und zieht sich oft sehr. Teilweise fand ich es auch sehr zäh und langweilig oder schlicht uninteressant.
Dabei hatte die Geschichte soviel Potenzial das leider nicht genutzt wurde. Gut fand ich wie die Autorin uns vermittelt hat das die Vergangenheit auch immer noch in der Gegenwart mitspielt und auch oft die nächsten Genrationen noch darunter leiden was die Eltern oder Großeltern erlebt haben.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Wenig sibirische Gefangenschaft, viel deutsche ländliche Einöde
1945: Nachdem die Familie über Generationen in Galizien gelebt hat, wurden die Ambachers 1939 zunächst von den Nazis ins Wartheland umgesiedelt. Nun, nach Ende des Krieges, werden der 10-jährige Josef …
Mehr
Wenig sibirische Gefangenschaft, viel deutsche ländliche Einöde
1945: Nachdem die Familie über Generationen in Galizien gelebt hat, wurden die Ambachers 1939 zunächst von den Nazis ins Wartheland umgesiedelt. Nun, nach Ende des Krieges, werden der 10-jährige Josef Ambacher, sein kleiner Bruder, seine Mutter, Tante und Großeltern nach Sibirien deportiert. Auf dem Weg stirbt bereits sein kleiner Bruder und das wird nicht der einzige Verlust bleiben. Die Ambachers sind nur einige der Zivilverschleppten.
1990: Leila stromert mit ihrem Freund Arnold durch das niedersächsische Örtchen Mühlheide und die umliegende Natur. Fasziniert lauscht sie immer wieder den Geschichten ihres Vaters aus seiner Kindheit und merkt dabei immer wieder deutlich, dass sie anders sind als viele der Mühlheidener. Als 1990 mit dem Ende der Sowjetunion viele Russlanddeutsche, die Neuankömmlinge, nach Mühlheide verschlagen werden, ist Josef Ambacher ihr Anker und Leila muss sich neben dem Erwachsenwerden auch damit auseinandersetzen, was diese Menschen, aber auch ihr Vater, in der Vergangenheit erlebt haben und wie sie alle versuchen, neue Wurzeln zu schlagen.
Auf dieses Buch habe ich mich sehr gefreut und ich hatte große Erwartungen. Generell finde ich die Idee gut, zwei Kindheiten zu unterschiedlichen Zeiten parallel laufen zu lassen, um die völlig verschiedenen Lebensbedingungen darzustellen. Josef, der in der kasachischen Steppe wortwörtlich mit seiner Familie ums Überleben kämpft vs. Leila, die in Mühlheide gut versorgt ist, aber als Kind von Russlanddeutschen eben doch immer wieder ausgegrenzt wird. Letztlich lebt in ihr das Erbe von Josefs Kindheitserfahrungen weiter. Trotzdem war mir das zu wenig. Die Verbindungen waren mir zu schwach verknüpft, dafür wurden für meinen Geschmack unnötig lang viele von Leilas mitunter recht trivialen Erlebnissen ausgewalzt. Die Perspektive wechselte regelmäßig zurück zu Josef in Sibirien, jedoch stand der Umfang der beiden Handlungsstränge in keinem ausgeglichenen Verhältnis. Die Szenen aus Sibirien waren mir zu kurz und immer, wenn es hier spannend wurde, wechselte die Handlung zurück in das gemächliche Mühlheide. Da ich bislang so wenig wusste über die Zivilverschleppung, hätte ich gern deutlich mehr darüber erfahren. Auch hätten die Erfahrungen der Familie Ambacher in Sibirien insgesamt deutlicher beleuchtet werden können. Mitunter bekam ich den Eindruck, für Josef war es weniger traumatisierend und mehr ein großes Abenteuer, obwohl eigentlich überall Mangel herrschte. Auch konnte ich mit zu wenig Hintergrundwissen, das in dem Buch auch nicht vermittelt wurde, die Handlung nicht gut einordnen. Glücklicherweise bin ich während des Lesens dieses Buches auf eine TV-Dokumentation über Zivilverschleppte gestoßen, die mir erst einmal deutlich gemacht hat, dass die Ambachers wohl zu Adenauers Rückgeführten gehört haben müssen, während viele andere erst 1990 aus der Gefangenschaft entlassen wurden in ein Land, dem sie zwar des Passes zufolge angehörten, das aber schon ihre Vorfahren gar nicht mehr kannten, weil seit Jahrhunderten in Polen, Russland oder der Ukraine siedelten. Erst mit diesem Zusatzwissen wurde auch vieles aus dem Mühlheide-Handlungsstrang nachvollziehbarer. Insgesamt war ich von diesem Buch also eher enttäuscht und hätte mir mehr Sibirien und weniger deutsche ländliche Einöde erhofft. Auch wenn hier wichtige und bislang wenig thematisierte historische Ereignisse beleuchtet werden, konnte mich das Buch emotional leider nur wenig erreichen. Nebenstränge wie die zu einem alten SS-Offizier oder lebenslang gehegte Schuldgefühle konnten weder die Spannung noch meine emotionale Beteiligung am Geschehen retten. Ich bleibe trotz einiger Denkanstöße insgesamt eher verwirrt und unzufrieden zurück.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für