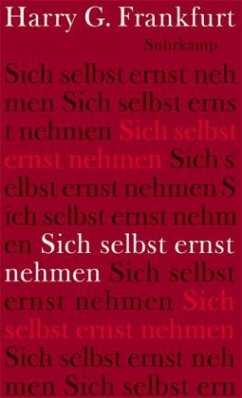Menschen sind sonderbare Wesen. Sie beschäftigen sich intensiv mit sich selbst, fragen sich, wer sie sind und was sie tun sollen. Sie hassen das Gefühl, von undurchsichtigen Impulsen gesteuert zu sein, und möchten, daß ihre Gedanken und Gefühle Sinn ergeben. Kurzum: Menschen besitzen vermutlich als einzige Spezies auf diesem Planeten die Fähigkeit, sich selbst ernst zu nehmen. Was aber heißt es genau, sich selbst ernst zu nehmen?Für Frankfurt ist die Fähigkeit, sich selbst ernst zu nehmen, untrennbar verbunden mit zwei anderen Aspekten der menschlichen Natur: der Vernunft und der Liebe. Die Vernunft gebietet über unseren Verstand, die Liebe über unser Herz; praktische Vernunft und Liebe liefern uns die Gründe für unser Tun und Lassen und spielen damit eine entscheidende Rolle für unser Selbstverständnis als über sich selbst reflektierende Personen, die aus freien Stücken handeln. Allerdings, so Frankfurts zentrale These, ist es die Liebe, die das normative Zepter in der Hand hältund die praktische Vernunft regiert. Lieben, das heißt für Frankfurt: sich sorgen - um etwas oder um jemanden. Und sich sorgen heißt: etwas intensiv wünschen, wollen oder begehren. Es ist also die Logik der Sorge, die unser Denken und Handeln im Kern bestimmt und die Frankfurt in diesem Buch auf gewohnt souveräne Weise erkundet.

Wie bringen wir mit dem Kopf unser Leben in Form?
Soeben ist ein Buch über die Geschichte des Parkhauses erschienen. Es heißt "Übersehene Räume", Jürgen Hasse hat es verfasst (transcript Verlag). Das Parkhaus wird darin als typischer Ort der Moderne beschrieben, alles hat hier seinen Platz und seine Richtung - um dann scharf als Chiffre der Ortlosigkeit hervorzutreten. Eine Büchersaison, in der ein Buch über Parkhäuser erscheint, zumal ein so gelungenes, ist eine gute Saison.
Warum? Weil so ein Buch an den Nerv des Lebensgefühls von 2007 rührt, an das Gefühl, nicht mehr selbstverständlich heimisch werden zu können. Heute kann keiner mehr erwarten, in gemachte Nester zu kommen (ökonomisch, metaphysisch). Heute ist man mehr denn je auf sich selbst angewiesen, auf die Fähigkeit zum selbständigen Denken, um sich seinen eigenen Lebensort zu erschließen und ihn gegen den Sog der Gesichtslosigkeit zu behaupten. Welche Haltung dafür nötig ist, legt der Philosoph Harry Frankfurt in einem kleinen Bändchen dar: "Sich selbst ernst nehmen" (Suhrkamp). Sich selbst ernst zu nehmen, ist nicht selbstverständlich. Selbstbestimmung ist zwar in aller Munde. Aber die wichtigste Voraussetzung für Selbstbestimmung, verstehen wir Harry Frankfurt recht, bleibt oft ungenannt: sich selbst ändern zu wollen.
Sie ist weniger eine Frage des sogenannten Gehirnjoggings - Motto: Frischluft und Pflegetipps fürs Gehirn! -, mit dem uns die vielen aus dem Bücherwald schießenden Gehirnjogger vertraut machen, etwa mit dem Knobelband "Gehirnjogging für kluge Köpfe" (Moewig). Nein, die Fähigkeit, sich selbst ernst zu nehmen, hat weniger mit Knobelkunst und IQ-Training zu tun als vielmehr mit der ruhigen Kunst des Nachdenkens, mit dem, was man etwas altmodisch Schule des Denkens nennt. Wie das geht, sich im Denken zu orientieren, ist die leere Mitte, um die die Gehirnjogger in immer neuen Anläufen vergeblich herumschreiben. Tatsächlich gibt es zwei Reaktionen, die uns daran hindern, unser Leben in Form zu bringen: die defätistische Reaktion (Schwarzseherei) und die phobische Reaktion (Angst). Versucht man, die Bücher dieses Herbstes jenen beiden Reaktionsmustern zuzuordnen, sei es als Diagnose oder als Therapie, macht man beachtliche Funde.
Als Therapie gegen Schwarzseherei bringt Jörg Blech die "Bewegung" ins Spiel (S. Fischer). Sein Aufruf, sich körperlich mehr zu bewegen, ist ein Statement in den Zeiten des Reflexionsüberschusses und der Formlosigkeit. Sich in Form bringen - das beginnt für Blech beim body. Solange man selbst nicht mit geradem Rücken voransitzt, soll man anderen nichts von Haltung erzählen oder ihnen wie Judith Rich Harris sehr intelligent das Prinzip "Jeder ist anders" erklären wollen (DVA). Warum nicht erst einmal den Gang ins Fitnessstudio antreten, bevor der Bandscheibenvorfall eintritt, weil die Wirbelsäule wieder einmal nicht hinreichend mit Muskeln eingepackt war? Dass die Krankenkassen im Rahmen der Prävention den Studiobesuch nicht bezuschussen (obwohl sie mit der Bezuschussung viel Geld sparen würden), gehört zu den Widersinnigkeiten krank machender Politik.
Es ist eben nicht so wie früher, als die Deutschen noch gegen Sümpfe, Flüsse und Meere zu kämpfen hatten und, wie das lehrreiche Buch von David Blackbourn schildert, alle Körperkräfte auf die "Eroberung der Natur" lenkten (DVA) - diese Zeiten sind vorbei. Heute steht der unbeanspruchte Körper von Kindesbeinen an unter dem Zivilisationsrisiko, dick und fett und kugelrund zu werden.
So wird einem die Schwarzseherei gewissermaßen in die Wiege gelegt, wie auf andere Weise das eindringliche Buch von Tracy Thompson über "Mütter und Depression" (Patmos) zeigt. Mit den verschleppten Depressionen der Mütter greift Thompson ein lange totgeschwiegenes Thema auf, sie klärt auf und hilft weiter. Ihr Buch ist natürlich auch als Versuch zu lesen, die Familie trotz aller Widrigkeiten, die mit dieser Lebensform verbunden sind, als Lebensort zu stärken. Und nicht etwa das ortlos-alberne Pamphlet von Corinne Maier über "Vierzig Gründe, keine Kinder zu bekommen", zu befolgen (demnächst bei Rowohlt). Maier sollte lieber das kraftvolle Buch "Das geheime Königreich" über die "Oper für Kinder" lesen, das Elke Heidenreich und Christian Schuller publizierten (Kiepenheuer &Witsch). Dann hätte Maier eine Idee, wie wunderschön das ganze Kindertheater doch sein kann. Das Thema des Kindesmissbrauchs, diese gewalttätige, besonders grausame Form des Defätismus, behandelt der Band "Es geschieht am helllichten Tag" von Manfred Karremann (DuMont), der monatelang undercover in der Pädophilen-Szene recherchierte. Ein Buch, das man allen Eltern nahelegen möchte, die ihre Kinder wirksam vor Missbrauch schützen wollen.
Dass Menschen in nächtlichen Parkhäusern phobisch werden können, davon hatte man schon gehört. Dass unsere Ortlosigkeit mittlerweile aber schon 500 (in Worten: fünfhundert) Phobien in die Register der Medizin eingetragen hat, das ist ein ebenso erstaunlicher wie bestürzender Befund. Der Psychologe Wolfgang Schmidbauer entfaltet ihn in seinem "Buch der Ängste" (Blumenbar). Seine Phänomenologie der Phobien wirft auch ein indirektes Licht auf unsere verzerrte Risikowahrnehmung: Gefahren werden uns meist nach der Häufigkeit, nicht aber nach der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens vor Augen geführt. Auf diese Art steigt die Anfälligkeit für das Phobische, die unseren Lebensort von innen her zerstört.
Ein Befund, so kommt es uns vor, der nur einmal mehr den Preis der Hyperinformation benennt: Expertenauskünfte verselbständigen sich, ohne dass noch hinreichend klar würde, auf welche Fragen sie überhaupt die Antwort sind. So werden wir schnell kirre, wenn wir nicht gelernt haben, unseren eigenen Kopf zu benutzen. Es gibt keinen Grund zur Panik: Nicht auf jeder Etage im schummrigen Parkhaus der Moderne lauert ein Gangster, beruhigt uns Borwin Bandelow im "Buch für Schüchterne" (Rowohlt). Borwin Bandelow hat, so scheint's, das Zeug, um in der Schule des Denkens den Direktor zu geben.
CHRISTIAN GEYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Die 2004 an der Standfort University gehaltenen Tanner Lectures, die mit diesem Band nun auf Deutsch vorliegen, führen konsequent die Hauptthemen des allgemein anerkannten Philosophen Henry Frankfurt fort und ziehen so etwas wie die Bilanz aus seinen Reflexionen, meint Rezensent Michael Schefczyk. Es dreht sich um die bei Frankfurt prominente Frage nach dem "Begriff der Identifikation" als zentrale menschliche Eigenschaft der Persönlichkeit, erklärt der Rezensent, der sich bemüht, dem Leser die Thesen des Philosophen zusammenzufassen. Laut Frankfurt sei der Mensch erst eins mit sich und seinem Handeln, wenn er wisse, was er liebe, und in diesem Rahmen vollziehe sich auch seine Willensfreiheit, referiert Schefczyk. Interessant scheinen ihm auch die drei kritischen Kommentare zu Frankfurts Überlegungen von Christine M. Korsgaard, Michael E. Bratmann und Meir Dan-Cohen, deren Einwände gegen die Ausführungen des Philosophen er ebenfalls darstellt. Dem letzten Kommentator mit seiner Kritik an der fehlenden sozialen Dimension im Gedankengebäude Frankfurts um die Freiheit des Willens kann sich der Rezensent nur anschließen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH