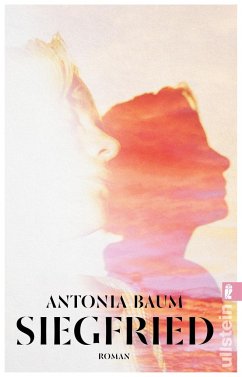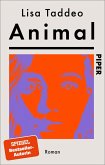Eine Frau zwischen alten Rollenverhältnissen und neuen Rollenansprüchen
Eine Frau - Mutter, Partnerin, Versorgerin - fährt eines Morgens nicht zur Arbeit, sondern in die Psychiatrie. Am Abend hat sie sich mit ihrem Partner gestritten, vielleicht ist etwas zerbrochen, jetzt muss sie den Tag beginnen, sie muss die Tochter anziehen, an alles denken, in der Wohnung und ihrem Leben aufräumen. Doch sie hat Angst: das Geld, die Deadline, die Beziehung, nichts ist unter Kontrolle, und vor allem ist da die Angst um ihren Stiefvater, der früher die Welt für sie geordnet und ihr einen Platz darin zugewiesen hat. In der Psychiatrie, denkt sie, wird jemand sein, der ihr sagt, wie ihr Problem heißt. Dort darf sie sich ausruhen.
Siegfried ist ein Roman über alte Ordnungen und neue Ansprüche, über Gewalt und das Schweigen darüber, über eine Generation, deren Eltern nach dem Krieg geboren wurden und deshalb glaubten, er sei vorbei.
Eine Frau - Mutter, Partnerin, Versorgerin - fährt eines Morgens nicht zur Arbeit, sondern in die Psychiatrie. Am Abend hat sie sich mit ihrem Partner gestritten, vielleicht ist etwas zerbrochen, jetzt muss sie den Tag beginnen, sie muss die Tochter anziehen, an alles denken, in der Wohnung und ihrem Leben aufräumen. Doch sie hat Angst: das Geld, die Deadline, die Beziehung, nichts ist unter Kontrolle, und vor allem ist da die Angst um ihren Stiefvater, der früher die Welt für sie geordnet und ihr einen Platz darin zugewiesen hat. In der Psychiatrie, denkt sie, wird jemand sein, der ihr sagt, wie ihr Problem heißt. Dort darf sie sich ausruhen.
Siegfried ist ein Roman über alte Ordnungen und neue Ansprüche, über Gewalt und das Schweigen darüber, über eine Generation, deren Eltern nach dem Krieg geboren wurden und deshalb glaubten, er sei vorbei.
«So unausgesprochen wie exemplarisch porträtiert Antonia Baum drei deutsche Nachkriegsgenerationen, bis hin zu den Enkeln, die doch plötzlich von Ängsten und Wünschen heimgesucht werden, denen sie schon entkommen zu sein glaubten.» Eva Behrendt taz 20230501
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Der vierte Roman von Antonia Baum ist der Selbsterfahrungstrip einer Frau, deren biografische Daten denen der Autorin erstaunlich ähneln, schreibt Rezensentin Eva Behrendt. Die Erzählerin ist Schriftstellerin, lebt mit Kind in Berlin, hat einen Liebhaber und sich nach einem Alptraum selbst in die Psychiatrie eingewiesen. Dort sinniert sie über ihre Mutter, die Macht von Stiefvater Siegfried und die der nazistischen Großmutter. Der Ton dieser Geschichte sei wieder "eindringlich und intim", schreibt Behrendt und bewundert die Offenheit des erzählenden Ichs, das für die Rezensentin als Zeichen der Redlichkeit von der Autorin allerdings etwas überstrapaziert wird. Trotzdem beeindruckt Behrendt der Versuch der Protagonistin, in den Spiegel von drei deutschen Nachkriegsgenerationen zu schauen, um feststellen, dass man den in der Familiengeschichte angelegten Ängsten nicht entkommen kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH