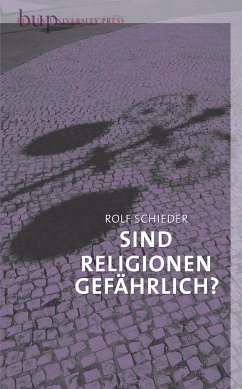Die Geschichte von Kain und Abel zeigt, wie lebensgefährlich Religionen sind. Kain erschlägt seinen Bruder Abel, weil er glaubt, dessen Opfer habe Gott besser gefallen. Gott selbst hatte Kain vor der Tat gewarnt. Ist Gott Religionskritiker? Wie gefährlich sind Religionen? Der Versuch, darauf eine theologisch und religionsgeschichtlich gebildete Antwort zu geben, wird angesichts der zunehmend schriller werdenden Meinungsäußerungen von Intellektuellen mit höchst unterschiedlichem Kenntnisstand dringlich. Eine sachgemäße und ausgewogene Antwort hängt von der Beantwortung folgender Fragen ab: Welcher Religionsbegriff soll einer Analyse zugrunde gelegt werden? Blickt man nur auf die so genannten Weltreligionen oder müssen auch politischen Religionen einbezogen werden? Worin genau liegt das Gefahrenpotential von Religionen? In ihrer Irrationalität? In ihrer Motivationskraft zum Selbstopfer? In ihrer sozialen Bindekraft?In ihrer im Vergleich mit politischen Systemen weitaus höheren Lebensdauer? In ihrer Transnationalität? Und für wie gefährlich halten eigentlich die Religionen Religion? Welche größere oder geringere Demokratie- und Pluralismusaffinität haben die großen Weltreligionen? Man wird rasch feststellen, dass die unterschiedslose Rede vom Christentum die Sachverhalte ebenso verdunkelt wie die Behauptung, die monotheistischen Religionen" seien besonders gefährlich. Neue Untersuchungen zur Rolle der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften in den verschiedenen Krisengebieten zeigen, dass es neben einem unbestreitbaren Konfliktpotential auch ein beträchtliches Friedenspotential religiöser Gruppen gibt. Die Frage stellt sich dann, wie man die Religionen so zivilisieren kann, dass ihr Friedenspotential gestärkt und ihr Potential, zur Eskalation von Konflikten beizutragen, minimiert werden kann.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Uneingeschränkt begeistert ist Niklaus Peter von diesem Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, ob "Religionen gefährlich" sind. "Glänzend", "informativ" und "klar argumentiert" sind die Attribute, die der Rezensent dem Buch zuerkennt, das, wie er betont, eine brandaktuelle Debatte aufgreift. Sehr differenziert lege Rolf Schieder dar, dass Religion keine Gefahr, sondern ein Risiko darstelle, mit dem man sich reflektiert auseinandersetzen müsse, so der Rezensent zustimmend. Und das tut Schieder dann auch, indem er über den Zusammenhang von Religion und Terrorismus nachdenkt und "Verständnis" für "Religionsrealitäten" zu wecken sucht, wie Peter interessiert feststellt. Besonders anregend und überzeugend findet er offenbar auch Schieders kontroverse Auseinandersetzung mit Jan Assmanns Monotheismus-These, die in der "mosaischen Unterscheidung" zwischen wahrem Gott und falschen Göttern die Wurzel der religiösen Gewalt sieht. Am Ende plädiert der Autor für eine Religionspolitik, die eine Zusammenarbeit von staatlichen und religiösen Stellen ermöglicht, ohne die staatliche Neutralität zu untergraben, teilt Peter noch mit, der noch einmal bekräftigt, wie wichtig und lohnenswert dieses Werk ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH