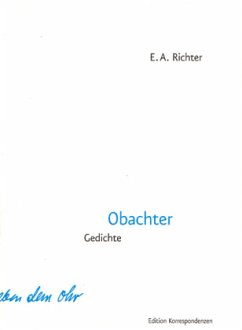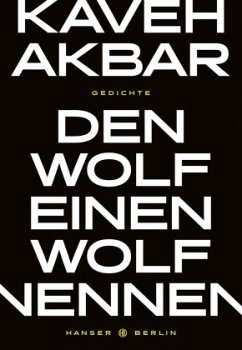Sinnenleben
Eine Philosophie
Übersetzung: Gutberlet, Caroline

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
Der Bestsellerautor von "Die Wurzeln der Welt" darüber, wie unsere Sinne uns in der Welt verorten. "Dieses Buch ist eine ganz besondere Überraschung." Le MondeDas menschliche Leben besteht wesentlich im Sehen, Fühlen, Schmecken und Riechen der Welt. Dennoch spielte das Sinnliche in der Philosophie lange keine Rolle. Emanuele Coccia, Professor für Philosophiegeschichte in Paris, stellt dieser Denktradition einen anderen Ansatz entgegen. In seinem originellen Essay widmet er sich dem "Sinnenleben" und zeigt: Erst durch das Vermögen unserer Sinne hängen wir an der Welt und hängt die Welt a...
Der Bestsellerautor von "Die Wurzeln der Welt" darüber, wie unsere Sinne uns in der Welt verorten. "Dieses Buch ist eine ganz besondere Überraschung." Le MondeDas menschliche Leben besteht wesentlich im Sehen, Fühlen, Schmecken und Riechen der Welt. Dennoch spielte das Sinnliche in der Philosophie lange keine Rolle. Emanuele Coccia, Professor für Philosophiegeschichte in Paris, stellt dieser Denktradition einen anderen Ansatz entgegen. In seinem originellen Essay widmet er sich dem "Sinnenleben" und zeigt: Erst durch das Vermögen unserer Sinne hängen wir an der Welt und hängt die Welt an uns. In Auseinandersetzung mit der Geistesgeschichte von Aristoteles bis Merleau-Ponty, von Averroes bis Helmuth Plessner entspinnt er Stück für Stück die Grundzüge einer Philosophie des Sinnlichen - des Sinnenlebens.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.