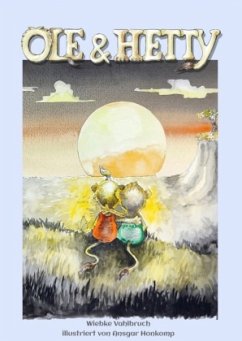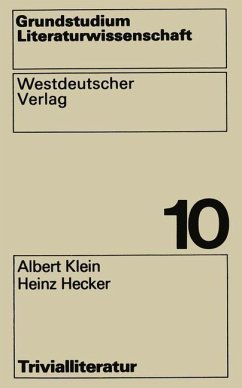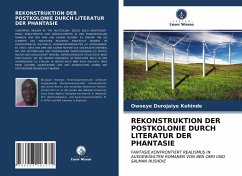Nicht lieferbar

Skeptische Phantasie
Eine andere Geschichte der frühneuzeitlichen Literatur
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Frühe Neuzeit ist mehr und anderes als bloße Vormoderne. Nicht erst die aktuelle "Selbstsorge"-Diskussion hat deutlich gemacht, in welchem Ausmaß sich diese Epoche unter Rückgriff auf bestimmte hellenistische Denkfiguren zu verstehen suchte. Dabei ist ihr auffallendes Interesse an der antiken Skepsis eher unbemerkt geblieben. Ebensowenig scheint die - bei allen Differenzen der jeweiligen Verwandlungsgestalten - nur wenig gebrochene Überlieferungskontinuität des neuplatonischen Denkens bisher in das literaturwissenschaftliche Blickfeld gerückt zu sein. Das ist erstaunlich. Denn die f...
Die Frühe Neuzeit ist mehr und anderes als bloße Vormoderne. Nicht erst die aktuelle "Selbstsorge"-Diskussion hat deutlich gemacht, in welchem Ausmaß sich diese Epoche unter Rückgriff auf bestimmte hellenistische Denkfiguren zu verstehen suchte. Dabei ist ihr auffallendes Interesse an der antiken Skepsis eher unbemerkt geblieben. Ebensowenig scheint die - bei allen Differenzen der jeweiligen Verwandlungsgestalten - nur wenig gebrochene Überlieferungskontinuität des neuplatonischen Denkens bisher in das literaturwissenschaftliche Blickfeld gerückt zu sein. Das ist erstaunlich. Denn die frühneuzeitliche Literatur schöpft aus eben diesen Quellen. Sie nimmt mit bemerkenswerter Verve und zugleich mit guten, systematischen Gründen eine ganz neuartige imaginative Potenz in Anspruch, die sich sowohl fortdauernden platonisierenden Eigentlichkeitsobsessionen als auch einer skeptisch radikalisierten Kritik und Relativierung bisheriger Figurationen des Absoluten verdankt. Die hier vorgelegte Literaturgeschichte unternimmt es, in exemplarischen Lektüren einiger der berühmtesten und verschiedener weniger bekannten Texte im Gang von der Programmschrift der pyrrhonischen Skepsis über den Cusaner, Montaigne, Shakespeare und Cervantes bis zu Autorinnen der englischen Restaurationszeit zu zeigen, inwiefern skeptisch-platonisches Denken ein Wegweiser in die Literatur als eigenes Erkenntnismedium ist. Nicht zufallig erweist sich dabei die skeptische Pose mehr als einmal als melancholische. Und spätestens bei einer so notorischen Autorin wie Aphra Behn und in den Paradoxien von Leben und Werk der von Leibniz hochgeschätzten Philosophin Anne Conway zeichnen sich in der Fülle der Affären zwischen Skepsis und Imagination zudem überrraschende Affinitäten zwischen literarischer Suchbewegung und weiblicher Exzentrizität ab. Diese historische Profilierung einer systematischen Grundlegung frühneuzeitlicher Literatur zwischen Aporie und Gewißheit läßt die Texte sowohl in ihrer "Anders"- und Eigenheit als auch in ihren protomodernen Qualitäten - ob gender- oder kulturwissenschaftlich konturiert - neu wahrnehmbar werden.
Von derselben Autorin:
- Verena Olejniczak: Subjektivität als Dialog. Philosophische Dimensionen der Fiktion. Zur Modernität Ivy Compton-Burnetts; 468 Seiten. Geb. DM 138,-
ISBN 3-7705-2906-5, Reihe: Übergänge 27
Von derselben Autorin:
- Verena Olejniczak: Subjektivität als Dialog. Philosophische Dimensionen der Fiktion. Zur Modernität Ivy Compton-Burnetts; 468 Seiten. Geb. DM 138,-
ISBN 3-7705-2906-5, Reihe: Übergänge 27