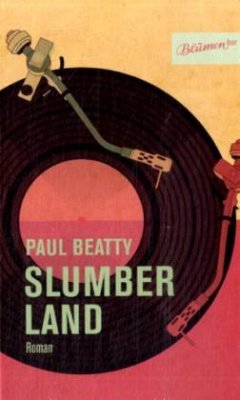Berlin, 1989. DJ Darky geht ins Solarium und erklärt das Ende der Blackness obwohl er mit unzähligen rassistischen Projektionen konfrontiert wird. »Slumberland« ist ein furioser, gnadenlos komischer Roman und eine Liebeserklärung an die Musik und ihre vereinigende Kraft.
DJ Darky hat ein phonographisches Gedächtnis. Nachdem er in Los Angeles den perfekten Beat kreiert hat, begibt er sich auf die Spuren des legendären, in Ostdeutschland abgetauchten Jazz-Avantgardisten Charles Stone, genannt Schwa, seinem musikalischen und spirituellen Doppelgänger. Die Suche führt ihn nach Berlin zur Zeit des Mauerfalls, wo er eine Stelle als Jukebox-Sommelier in der Bar »Slumberland« antritt. Er entdeckt seine sexuelle Macht, lernt den Musikgeschmack eines Neonazis kennen und vergleicht die Situation der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung mit der der Afroamerikaner nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Paul Beatty spielt virtuos mit den Verhältnissen zwischen den Geschlechtern, zwischen Schwarz und Weiß, Ost und West, Jazz und Techno, und mischt daraus einen mitreißenden neuen Sound.
DJ Darky hat ein phonographisches Gedächtnis. Nachdem er in Los Angeles den perfekten Beat kreiert hat, begibt er sich auf die Spuren des legendären, in Ostdeutschland abgetauchten Jazz-Avantgardisten Charles Stone, genannt Schwa, seinem musikalischen und spirituellen Doppelgänger. Die Suche führt ihn nach Berlin zur Zeit des Mauerfalls, wo er eine Stelle als Jukebox-Sommelier in der Bar »Slumberland« antritt. Er entdeckt seine sexuelle Macht, lernt den Musikgeschmack eines Neonazis kennen und vergleicht die Situation der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung mit der der Afroamerikaner nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Paul Beatty spielt virtuos mit den Verhältnissen zwischen den Geschlechtern, zwischen Schwarz und Weiß, Ost und West, Jazz und Techno, und mischt daraus einen mitreißenden neuen Sound.

Paul Beatty schickt einen DJ-Sommelier nach Berlin
Welche Farbe hat der fast perfekte Beat? Welche der Klang einer Bratsche? Letzterer ist hellmalachitgrün. So glaubt zumindest Ferguson W. Sowell alias DJ Darky, der behauptet, ein phonographisches Gedächtnis, ja bionische Ohren zu besitzen. Er sieht sich als "schwarzes Kind, hineingeboren in eine verbrauchte Welt von gestern". Der amerikanische Autor Paul Beatty hat für seinen diskursgesättigten Roman "Slumberland" diesen Intellektuellen auf die Reise ins Berlin der Wendezeit geschickt, wo eine Utopie als Diktatur endet und ein neues Wunschbild entsteht.
DJ Darky sucht nach einem mysteriösen Freejazzer namens Charles Stone, genannt "Der Schwa". Um über die Runden zu kommen, hat er den Beruf des Jukebox-Sommeliers erfunden, den er in der titelgebenden Bar ausüben darf - was allemal besser ist, als weiterhin Pornofilme mit einem verqueren Soundtrack zu versehen, wie er es früher getan hat. Was mit dem Aufbau einer Berliner Klangmauer endet, die von Ost und West jeweils unterschiedlich wahrgenommen wird, ist im Kern ein sarkastisches und hellwaches Spiel mit den Zuschreibungen von Identität. Beattys Ich-Erzähler erklärt zwar schon zu Beginn des Romans das Konzept der "Blackness" für erledigt, doch nur unter dem Vorwand, sich an diesem Thema anschließend erschöpfend abzuarbeiten. Dabei führt er eine Diskussion über Rassismus und Nationalismus, über Sexismus und Nonkonformismus, wobei er den eigentlichen Plot gelegentlich aus den Augen verliert. Doch immer wieder gelingt es ihm, seine klugen, manchmal satirischen Erörterungen zur Quelle des Romans zurückzuführen, zu der allumfassenden, wandlungsfähigen Kraft der Musik, einem "Beat, so vollkommen, dass seither sämtliche musikalischen Genreeinteilungen null und nichtig sind. Eine Melodie, so überirdisch, dass Schwarzsein offiziell passé ist."
Im Zentrum von Beattys Erzählwerk steht also ein buntes Tonreich mit einem ungeheuren utopischen Potential. Die Möglichkeit zur Abgrenzung, zur Behauptung einer Individualität, die in der Musik jeder Subkultur angelegt ist, wäre damit obsolet. Doch Beatty ist ein viel zu gewiefter Schriftsteller, um diese Möglichkeit außer Acht zu lassen. Seine musikalische Farbenlehre, die des Öfteren an die als Romane getarnten popkulturellen Magisterarbeiten eines Thomas Meinecke erinnert, lädt im Laufe des Geschehens zu zahlreichen synästhetischen Metaphern ein. So über einzelne Platten, Interpreten und den Klang der Welt an sich zu schreiben erweitert die Gefäße der Sprache, macht sie durchlässiger, biegsamer und aufnahmefähiger. Vor allem aber entsteht dabei ein sinnlicher, humorvoller und spielerischer Sound von ganz eigener Qualität, der von Rap, Techno und Jazz ebenso geprägt ist wie von William Faulkners "Schall und Wahn". Die deutsche Band "Tocotronic", die ihr jüngstes Album danach benannte, könnte vielleicht ein Liedchen davon singen.
In Beattys Schlummerland, einem Zwischenreich zwischen Tag und Nacht, zwischen Schwarz und Weiß, Ost und West, gibt allerdings die Methode des Samplings den Ton an. Beatty mischt die Sprache neu ab, so dass daraus eine rhythmische, vielschichtige und widerständige Komposition entsteht. Sein literarisches DJ-Set ist unerhört komisch und lesenswert.
ALEXANDER MÜLLER
Paul Beatty: "Slumberland". Roman. Aus dem Englischen von Robin Detje. Blumenbar Verlag, München 2009. 319 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Dieser Stimme ist Rezensent Ekkehard Knörer sofort verfallen: Hochmusikalisch sei sie, von sprachlich unglaublicher Virtuosität und einfach umwerfendem Witz. Dass Paul Beatty das absolute Gehör besitzt, steht für den Rezensenten ganz klar fest. Denn dass es in dem Roman um einen DJ geht, der kurz vor dem Mauerfall von New York nach Berlin kommt, um nach einem verschollenen Jazzmusiker zu suchen, scheint nur einen ungefähren Anhaltspunkt davon zu geben, worauf es in diesem Buch ankommt. Denn in seinem DJ-Mix bringe Beatty zusammen, was bis dahin nicht zusammengehörte: Nazis und Schwarze, Soul und Horst Wessel und "außerdem den perfekten Beat und Vokuhila-Frisuren". Das Ganze folge einer wahnwitzigen "Hybridisierungslust", wie Knörer frohlockt, der es selbst auf die gutgelaunte Formulierung bringt, bei diesem Buch gehe es darum, Identitäten und ihre Festschreibungen "durch kühnes Mixen in einen Zustand polymorpher Rekombinationsgeilheit" zu bringen. Und dass dies von Robin Detje ohne größere Reibungsverluste aus dem Amerikanischen übersetzt wurde, grenzt für den euphorisierten Rezensenten an ein Übersetzungswunder.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH