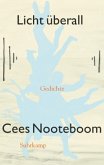Cees Nooteboom ist dem Publikum bekannt als Autor berühmter Romane (wie Rituale, Die folgende Geschichte, Allerseelen) oder als Reisender, der Gesehenes und Erlebtes auf einzigartig impressive Weise zu beschreiben versteht (Der Umweg nach Santiago, Nootebooms Hotel), der Kern seines Werks ist jedoch seit jeher: die Poesie, das Gedicht. »Beim Dichten versucht man, etwas Wesentliches in knapper Form zu sagen und das Gedicht praktisch 'als Ding' entstehen zu lassen«, was zur Folge - oder zur Voraussetzung - hat, daß der Dichter selbst danach streben muß, »offen wie eine Muschel, geschlossen wie ein Stein« zu sein, wie es in einem Vers Nootebooms heißt.
Bis heute hat Cees Nooteboom in den Niederlanden mehr als zehn Gedichtbände publiziert, bei Suhrkamp sind in den Neunzigern zwei größere Sammlungen erschienen, Gedichte und Das Gesicht des Auges. Jetzt, mit So könnte es sein, blickt der Autor zurück und nach vorne zugleich: Hundert Gedichten, die zwischen 1956 und 1999 entstanden sind, fügt er siebzehn neue Texte hinzu, ruhige, konzentrierte und zugleich spannungsgeladene Verse, geschrieben in einer unverwechselbar schönen Sprache, mit größtem Formbewußtsein. So könnte es sein zeigt in aller Deutlichkeit das poetische Universum, in dem Nooteboom zu Hause ist und in dem sein lyrisches Ich die ihm begegnenden Widersprüche erfährt: »Sensitive Impressionabilität und Schärfe der Abstraktion, sinnliche Lust an der konkreten Welt und Leidenschaft der Transzendenz. Ruhelose Entdeckerneugier und konzentrierte Ruhe der Meditation« (Paul Hoffmann).
Bis heute hat Cees Nooteboom in den Niederlanden mehr als zehn Gedichtbände publiziert, bei Suhrkamp sind in den Neunzigern zwei größere Sammlungen erschienen, Gedichte und Das Gesicht des Auges. Jetzt, mit So könnte es sein, blickt der Autor zurück und nach vorne zugleich: Hundert Gedichten, die zwischen 1956 und 1999 entstanden sind, fügt er siebzehn neue Texte hinzu, ruhige, konzentrierte und zugleich spannungsgeladene Verse, geschrieben in einer unverwechselbar schönen Sprache, mit größtem Formbewußtsein. So könnte es sein zeigt in aller Deutlichkeit das poetische Universum, in dem Nooteboom zu Hause ist und in dem sein lyrisches Ich die ihm begegnenden Widersprüche erfährt: »Sensitive Impressionabilität und Schärfe der Abstraktion, sinnliche Lust an der konkreten Welt und Leidenschaft der Transzendenz. Ruhelose Entdeckerneugier und konzentrierte Ruhe der Meditation« (Paul Hoffmann).

Freier Fall: Cees Nootebooms Lyrik · Von Tobias Döring
Verben sind rar in den Gedichten von Cees Nooteboom. Daß "etwas gräbt, klopft, will, wächst", wie im Gedicht "Frühling", kommt nur selten vor und entpuppt sich bald als geisterhafter Spuk. Vielleicht will der Autor das Dynamische von Tätigkeits- und Zeitworten seiner Erzählprosa vorbehalten. Jedenfalls dominieren in seiner Lyrik Substantive; sie verleihen ihr oft den Charakter von Standbildern, poetischen Bestimmungsversuchen, die sich dem Zeitfluß ständiger Veränderung entgegenstemmen. Denn wenn den Verben doch einmal eine prominente Rolle zukommt, dann eher wie beim Titelgedicht in ihren Möglichkeits- und Wunschformen: "So könnte es sein" erinnert daran, daß jeder Verständigung über die Welt eine Vergewisserung vorausliegt. Namensnennungen mögen da für Sicherheiten sorgen.
"Zwischen Meer und Meer / die Groden / hinter Deichen aus Tang. / Wassermenschen, Landmacher, / schwarze Engel, / Ahnen, rutschend über den Schlick." So knapp umreißt ein Gedicht das mittelalterliche Unternehmen, der Stadt Amsterdam eine Grundlage im Flüssigen zu schaffen, und scheint damit auch zu umschreiben, wie dieser niederländische Dichter im Flüchtigen die Grundlagen seiner Sprache sucht: "Sie sind die ersten. / Sie träumen Mauern aus Treibholz / in den wandernden Fluß. / Arme, Wasser. / Stelle, sicherer Ort. / Der Name ihrer flüssigen / Stadt."
Die neue Gedichtsammlung ist wie schon die vorigen von Ard Posthuma ins Deutsche übertragen worden. Präsentiert werden fünfzig reimlose und zurückhaltend rhythmisierte Texte aus zwei Bänden, die in den letzten beiden Jahren in Amsterdam erschienen sind. Was wir darin lesen, klingt oft vertraut, denn es variiert Nootebooms bewährte Themen und Motive. Zuweilen ein poeta doctus, der den Dialog mit den Vorsokratikern ebenso selbstverständlich wie mit chinesischen Lyrikern der T'ang-Dynastie pflegt, dann ein poetischer Reporter, der im Vorübereilen lakonische Momentaufnahmen übermittelt, endlich ein naturkundlicher Sammler, der sorgsam jedes sichtbare Detail im Beobachtungsbuch verzeichnet - das Repertoire der Sprechrollen, die Nooteboom durchspielt, ist vielfältig und doch zentriert. Das Gemeinsame liegt stets im Provisorischen, im Gestus eines probeweisen Sprechens: so ließe es sich sagen, so könnte es sein.
In schwachen Texten verführt dies mitunter zu kunstgewerblichen Montagen aus Zitaten und Klischees, die sich kaum von den vorrätigen Sprachmustern, die sie überprüfen sollen, unterscheiden. Wenn beispielsweise ein Gedicht die eigene schmerzhafte Genese munter kommentiert oder wenn die Bäume einer Landschaft ihrer Poetisierung widersprechen, setzt Nooteboom auf allzu einfache Effekte. Doch dafür entschädigt reichlich, was dieser neue Band an genuinen Erkundungen zu bieten hat, die, wie schon in "Das Gesicht des Auges" (1996), entschieden in den Bezirk des Visuellen vorstoßen.
Immer wieder sucht Nootebooms Lyrik die Herausforderung durch bildende Kunst. Stilleben, wie die des Spaniers Meléndez, verlieren allein dadurch jede ruhige Selbstgewißheit, daß hier ein poetisches Protokoll den Gegenständen, die sie zeigen, den bestimmten Artikel aufnötigt: "Käse, Kirschen, Pflaumen, Krug" klingt nach ewiger Erscheinung; "der Käse, die Pflaumen, die Kirschen, der Krug" dagegen rückt sie in das Konkrete von begrenzter Existenz und schafft, indem es sie demonstrativ zeigt, skeptische Distanz. Daß Poesie und Malerei Schwestern seien, wie ein alter Topos sagt, die einander zustreben und nacheifern, läßt sich hier auch so verstehen, daß sie Rivalinnen sind im Kampf um den besten Zugriff auf die Welt.
Am intensivsten wird dieses Spannungsverhältnis spürbar, wenn ein Gedicht auf ein Gemälde zielt, das seinerseits einen Dichter porträtiert. Nootebooms "Rilke, gemalt von Paula Modersohn-Becker, 1906" ist solch ein Fall von wechselseitiger Überbietung, bei dem die Geste respektvoller Ehrung unmerklich in kritische Musealisierung umschlägt. "Stehkragen, Ohren später angesetzt, / in der Mitte ein Klecks, / der hört, was die Welt verleugnet, / bevor das Dichten beginnt." Allein in dieser Strophe reicht die Spannweite von aufmerksamer Sichtung des Bildmaterials bis zu nachdrücklicher Behauptung dessen, was das Bild gerade nicht zeigt oder zeigen will. So überlagern sich auf dieser Leinwand Malerisches wie Poetisches.
Das Unfertige von Modersohn-Beckers Darstellung aber, das zu nachträglicher Ergänzung von des Dichters Ohren nötigt, verweist darauf, was Augenmenschen leicht in Vergessenheit gerät: Man muß sein Leben ändern, wenn man auf wichtige Gedichte hört. Es könnte sein, daß Cees Nootebooms neue Sammlung dafür Beispiele bereitstellt.
Cees Nooteboom: "So könnte es sein". Gedichte. Aus dem Niederländischen übersetzt von Ard Posthuma. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 120 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Hermann Wallmann bespricht einen Lyrikband von Nooteboom und einen Gedichtband von Eugenio Montale, zu dem Nooteboom das Vorwort geschrieben hat. Beide Bände geben ihm Aufschluss über die Poetik des niederländischen Autors. Die zweisprachige Gedichtsammlung des Autors Cees Nooteboom, in dem Gedichte aus zwei niederländischen Ausgaben von 1999 und 2000 neu zusammengestellt worden sind, beeindruckt den Rezensenten Herrmann Wallmann durch ihren Mut zur "existenziellen Pointe". Doch seien die Verse trotz ihrer "Deutlichkeit" völlig frei von "Redundanz", so Wallmann angetan, der sich durch sie zum "philosophischen Austausch" eingeladen sieht. Als charakteristisch empfindet er die Abkehr Nootebooms von Pathos und Opulenz zugunsten von Lakonie und der "Tendenz der Aufzählung", die durchaus seine Zustimmung erhält.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH