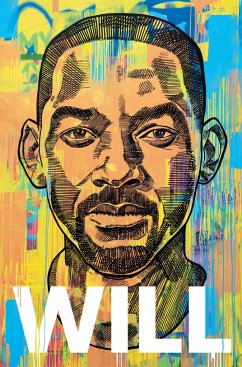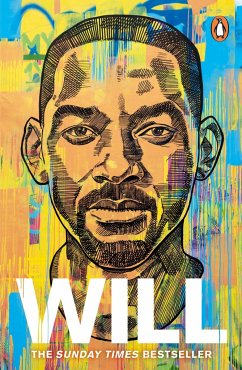So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein
Tagebuch einer Krebserkrankung

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nicht erst seit seiner Erkrankung an Lungenkrebs hat Christoph Schlingensief alles Private öffentlich gemacht. Er lässt uns alles wissen. Seine Schmerzen, seinen Husten, seine Verzweiflung, seinen Zorn – sofort hat er es umgesetzt in ein Theaterstück, das zugleich fasziniert und abschreckt, und in ein Buch, ein sehr privates, nun öffentliches Krankentagebuch. (Elke Heidenreich)
Ich habe lernen müssen, auf dem Sofa zu liegen und nichts anderes zu tun, als Gedanken zu denken.
Wie weiterleben, wenn man von einem Moment auf den anderen aus der Lebensbahn geworfen wird, wenn der Tod plötzlich nahe rückt? Mit seinem Tagebuch einer Krebserkrankung lässt uns Christoph Schlingensief teilhaben an seiner eindringlichen Suche nach sich selbst, nach Gott, nach der Liebe zum Leben.
Im Januar 2008 wird bei dem bekannten Film-, Theater- und Opernregisseur, Aktions- und Installationskünstler Christoph Schlingensief Lungenkrebs diagnostiziert. Ein Lungenflügel wird entfernt, Chemotherapie und Bestrahlungen folgen, die Prognose ist ungewiss - ein Albtraum der Freiheitsberaubung, aus dem es kein Erwachen zu geben scheint.
Doch schon einige Tage nach der Diagnose beginnt Christoph Schlingensief zu sprechen, mit sich selbst, mit Freunden, mit seinem toten Vater, mit Gott - fast immer eingeschaltet: ein Diktiergerät, das diese Gespräche aufzeichnet. Mal wütend und trotzig, mal traurig und verzweifelt, aber immer mit berührender Poesie und Wärme umkreist er die Fragen, die ihm die Krankheit aufzwingen: Wer ist man gewesen? Was kann man noch werden? Wie weiterarbeiten, wenn das Tempo der Welt plötzlich zu schnell geworden ist? Wie lernen, sich in der Krankheit einzurichten? Wie sterben, wenn sich die Dinge zum Schlechten wenden? Und wo ist eigentlich Gott?
Dieses bewegende Protokoll einer Selbstbefragung ist ein Geschenk an uns alle, an Kranke wie Gesunde, denen allzu oft die Worte fehlen, wenn Krankheit und Tod in das Leben einbrechen. Eine Kur der Worte gegen das Verstummen - und nicht zuletzt eine Liebeserklärung an diese Welt.
Wie weiterleben, wenn man von einem Moment auf den anderen aus der Lebensbahn geworfen wird, wenn der Tod plötzlich nahe rückt? Mit seinem Tagebuch einer Krebserkrankung lässt uns Christoph Schlingensief teilhaben an seiner eindringlichen Suche nach sich selbst, nach Gott, nach der Liebe zum Leben.
Im Januar 2008 wird bei dem bekannten Film-, Theater- und Opernregisseur, Aktions- und Installationskünstler Christoph Schlingensief Lungenkrebs diagnostiziert. Ein Lungenflügel wird entfernt, Chemotherapie und Bestrahlungen folgen, die Prognose ist ungewiss - ein Albtraum der Freiheitsberaubung, aus dem es kein Erwachen zu geben scheint.
Doch schon einige Tage nach der Diagnose beginnt Christoph Schlingensief zu sprechen, mit sich selbst, mit Freunden, mit seinem toten Vater, mit Gott - fast immer eingeschaltet: ein Diktiergerät, das diese Gespräche aufzeichnet. Mal wütend und trotzig, mal traurig und verzweifelt, aber immer mit berührender Poesie und Wärme umkreist er die Fragen, die ihm die Krankheit aufzwingen: Wer ist man gewesen? Was kann man noch werden? Wie weiterarbeiten, wenn das Tempo der Welt plötzlich zu schnell geworden ist? Wie lernen, sich in der Krankheit einzurichten? Wie sterben, wenn sich die Dinge zum Schlechten wenden? Und wo ist eigentlich Gott?
Dieses bewegende Protokoll einer Selbstbefragung ist ein Geschenk an uns alle, an Kranke wie Gesunde, denen allzu oft die Worte fehlen, wenn Krankheit und Tod in das Leben einbrechen. Eine Kur der Worte gegen das Verstummen - und nicht zuletzt eine Liebeserklärung an diese Welt.