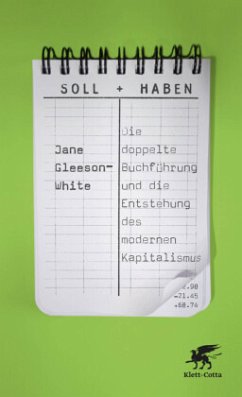Unsere Welt wird beherrscht von Zahlen, erzeugt in den Buchführungskonten von Nationen und Konzernen. Diese Zahlen bestimmen das Handeln unserer Regierungen und Volkswirtschaften. Aber wo kommen sie her - und wie konnten sie so mächtig werden? Erst die doppelte Buchführung ermöglichte die wirtschaftlich-kulturelle Blüte der Renaissance, und begründete zugleich eine neue wissenschaftliche Weltsicht und schließlich den Kapitalismus unserer Tage. Erst aus ihr entwickelte sich die Möglichkeit, ganze Staaten zu bewerten. Gleeson- White zeigt, wie sehr die doppelte Buchführung seit 500 Jahren unser Denken weit über ökonomisches Handeln hinaus prägt. Diese Entwicklung ist fatal, weil wir die wahren Gesamtkosten - inklusive Zerstörung unserer Umwelt und soziale Kosten - nicht in unser Handeln mit einbeziehen. Ein Plädoyer für ein neues Denken.

Ziemlich steile These: Jane Gleeson-White möchte zeigen, dass die doppelte Buchführung des kapitalistischen Übels Anfang war.
Alles fing ganz harmlos an. Einige venezianische Kaufleute begannen im hohen Mittelalter ihre Bücher so zu führen, dass sie einen schnellen Überblick über Ein- und Ausgänge hatten, vor allem aber stets informiert waren, wie ihr Geschäft stand. Denn sie trennten in einer Weise sauber zwischen den Vermögensbeständen und den jeweiligen Zu- und Abgängen, dass es ihnen nicht nur leichtfiel, zwischen eingesetztem Kapital und laufendem Gewinn und Verlust aus ihrem Geschäft zu unterscheiden. Sie konnten im Gegensatz zu anders buchhaltenden Kaufleuten überdies auch die Bedeutung einzelner Geschäfte sehr viel realistischer beurteilen und entsprechend geschickt handeln. Einmal im Jahr zog man Bilanz, korrigierte die Vermögensbestände je nach Gewinn und Verlust nach oben - und begann aufs Neue, dabei auf die gewinnbringenden Aktivitäten konzentriert.
Im Zuge der Zusammenfassung des Wissens im späten Mittelalter nun schrieb der Mönch Luca Pacioli, ein Zeitgenosse und Freund Leonardo da Vincis, eine Summa des mathematischen Wissens seiner Zeit, die auch ein Kapitel zur Buchführung enthielt. Pacioli war eigentlich nicht originell, er fasste lediglich zusammen, was zu seiner Zeit an mathematischem Wissen existierte. Aber Pacioli war der Erste, der die doppelte Buchführung mit arabischen Ziffern so beschrieb, dass mit diesem Wissen eigentlich eine grundlegende Änderung der Buchführung hätte eintreten können. Werner Sombart behauptete das auch: Die rationale Kapitalrechnung nach Luca Pacioli sei im Grunde die Geburtsstunde des Kapitalismus.
Diese These hat Jane Gleeson-White in ihrem Buch adoptiert. Dumm nur, dass seit einiger Zeit bekannt ist, dass die doppelte Buchführung vor dem 19. Jahrhundert keineswegs verbreitete Praxis war, zu einer Zeit also, als der Kapitalismus bereits in voller Blüte stand. Das stört Jane Gleeson-White aber nicht weiter. Anhand einer selektiven Blütenlese glaubt sie zeigen zu können, dass die neue Art der Buchführung zumindest das Denken seit jener Zeit infiltrierte. Praktisch sei die Doppik aber erst mit der Aktiengesellschaft zu großer Form aufgelaufen, um deren Erträge zu kontrollieren und die Unternehmen für die Geldanleger so transparent zu machen, dass diese das Risiko des Aktienkaufs eingingen.
Der Gläubigerschutz führte auch dazu, dass die Buchführung nicht nur staatlich vorgeschrieben, sondern mit den Wirtschaftsprüfern auch ein neuer Berufsstand geschaffen wurde, um deren Korrektheit zu attestieren. Auf diese Weise, so die Autorin, sei der Betrug endemisch geworden, denn die Wirtschaftsprüfer hätten das gerade nicht getan, was sie eigentlich tun sollten. Dafür verweist Gleeson-White auf amerikanische und australische Beispiele, ohne diese in der Tat erstaunlichen Betrügereien - etwa bei Enron - angesichts der Masse der korrekten Buchführungen zu gewichten. Das würde ihre These, wonach das Mittel, mit dem der Kapitalismus in die Welt kam und das ihn zugleich transparent machen sollte, faktisch zu dessen betrügerischem Alltag geworden ist, auch nur stören. Obwohl es doch genauso interessant wäre zu fragen, warum nach der Liberalisierung der Bilanzierungsregeln in den Vereinigten Staaten die große Masse der Unternehmen von den sich dadurch ergebenden Möglichkeiten keinen Gebrauch machte.
Aber die Autorin diskutiert ihre Behauptungen nicht kritisch, sondern zitiert bloß, was ihr ins Konzept passt. Für sie ist das Verhängnis der Buchführung auch nicht in den Bilanzfälschungen erschöpft. Es sei alles noch viel schlimmer gekommen, denn in der Weltwirtschaftskrise habe man diese Art der Buchführung auf ganze Volkswirtschaften ausgedehnt. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und ihr Kernstück, das Bruttoinlandsprodukt, hätten verheerende Folgen gehabt. Einerseits sei der Erfolg der volkswirtschaftlichen Steuerung nicht eingetreten; vor allem aber habe das BIP eine quantitative Wachstumsfixierung begründet, die geeignet sei, den Planeten zu zerstören. Denn seither schaue die Welt gebannt auf die Entwicklung eines Wertes, der die eigentliche Lebensqualität gar nicht abbilde, sondern im Gegenteil den Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen zugleich fordere und verschleiere. Mit Al Gore ist sie der Auffassung, das müsse sich ändern. Wogegen auch nichts spricht, sofern es wirtschaftlich vernünftig ist. Nur ist die Frage, in welchem Zusammenhang das Verhältnis von Wachstum, Ressourcenverbrauch und Rechnungswesen steht, nicht mit dem Verweis auf die allgemein bekannten Grenzen des BIP-Konzeptes beantwortet. Zumal die alternativen Berechnungsarten ebenfalls ihre Schwächen haben und - welche Ironie - in ihrer Aussagekraft die Valenz der BIP-Daten eher bestätigen.
Nein, die These, wonach uns das Rechnungswesen in den Abgrund führe, taugt nicht als Argument und ist eher einem Sachbuchmarkt geschuldet, der ohne steile Behauptungen nicht mehr auskommt. Insofern tut die Autorin etwas, das sie zugleich mit dem Buch beklagt, sie baut nämlich einen Popanz auf, um Markterfolg zu haben. Es ist nicht das Rechnungswesen, das die Betrügereien begeht. Und es ist auch nicht das BIP-Konzept, das die Meere verschmutzt. Zu einer ökonomisch rationalen Betrachtung der Welt als Voraussetzung und Bedingung wirtschaftlichen Handelns gibt es keine Alternative, auch wenn sich die Art der Betrachtung historisch wandelt, ja wandeln muss, wobei gerade in dieser Wandlungsfähigkeit ihre große Stärke liegt.
Das Ärgerliche an dem Buch ist nicht so sehr die durchsichtige These, sondern deren vermeintliche Begründung. Zu viele sachliche Fehler und Ungenauigkeiten enthält das Buch, zu selektiv ist die Literaturauswahl, zu sprunghaft und vor allem viel zu einseitig die Argumentation. Zweifel kennt die Autorin nicht, nur Unterstützer ihrer Sicht der Dinge oder andernfalls finstere Gestalten. Leser, die die These nicht ohnehin richtig finden, kann das nur ermüden.
WERNER PLUMPE.
Jane Gleeson-White: "Soll + Haben". Die doppelte Buchführung und die Entstehung des modernen Kapitalismus. Aus dem Englischen von Susanne Held. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2015. 366 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»So spannend und wichtig kann Buchhaltung sein.« Werner Fuchs, propeller.ch, März 2015 »Weit mehr als eine Kulturgeschichte der doppelten Buchführung von deren Anfängen in Mesopotamien im siebten Jahrhundert über ihre Weiterentwicklung im Italien des 15. Jahrhunderts bis zu der gegenwärtigen Krise des Kapitalismus. An dem damit einhergehenden Wachstumsdogma übt sie fundamentale Kritik, nicht ohne dabei eine ebenso umfassende wie originelle Analyse zu bieten: die des Zusammenhangs zwischen der Verbreitung des Buchführungswesens und der Ökonomisierung aller Lebensbereiche.« Jonas Weyrosta, Der Freitag, 26.3.2015