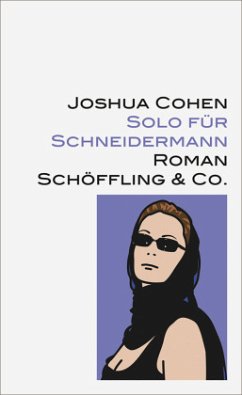In der New Yorker Carnegie Hall wird ein Violinkonzert aufgeführt, da kommt es zu einem Eklat. Der Geigenvirtuose Laster soll ein Solo improvisieren, doch stattdessen legt er sein Instrument nieder und hebt an zu einer Hommage an Schneidermann, den Komponisten des Stücks. Schneidermann ist nach dem letzten gemeinsamen Kinobesuch verschwunden. Vor der versammelten New Yorker High Society - darunter seine Exfrauen und deren Anwälte - erinnert Laster sich an all das, was die beiden durchlebt haben: Holocaust, Krieg und das Exil in Amerika. Mit seinem Loblied auf die Freundschaft fesselt er sein Publikum bis in die frühen Morgenstunden.In seinem Debütroman entwirft Joshua Cohen, einer der originellsten Autoren der jungen Generation und Absolvent der Manhattan School of Music, ein ungewöhnliches Künstlerporträt. Zugleich gibt SOLO FÜR SCHNEIDERMANN die Bühne frei für eine wilde Suada voller komischer Momente.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
"Solo für Schneidermann" ist ein enorm forderndes Buch, stellt Rezensent Burkhard Müller klar: Wer nicht in Lyrik, Musikbetrieb, Mythologie und Literaturgeschichte bewandert ist, wird an diesem Buch wenig Freude haben. Joshua Cohen lässt darin den Geiger Laster statt eines Konzert eine Grabrede auf seinen verstorbenen Freund, den Holocaust-Überlebenden und Meisterkomponistin Schneidermann halten. Die Eloge gerät Laster zu einer Abrechnung mit der gesamten Welt, und trägt dabei, so Müller, durchaus Züge eines Universal-Ressentiments, das er fast für inakzetabel hält. Dennoch nennt Müller den Roman "witzig, aberwitzig, emotional sehr stark", bleibt aber bei aller intellektuellen Brillanz etwas reserviert. Vorbehaltlos imponiert ihm allerdings Ulrich Blumenbachs bewundernswert virtuose Übersetzerleistung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Da hilft auch keine Therapie mehr: Joshua Cohens "Solo für Schneidermann" ist ein Schwanengesang auf die Moderne
Hätte Thomas Bernhard jemals einen New-York-Roman geschrieben, so wäre seine Hauptfigur vielleicht ein Schneidermann gewesen: ein die Geschmacksgrenzen bewusst übertretender Kritiker der spätkapitalistischen Gegenwart, ein zynischer Beobachter all ihrer Belanglosigkeiten, ein hoffnungslos elitärer Verteidiger abendländischer Tiefe, im Denken wie in der Kunst. Es wäre eine böse und witzige Suada geworden, eine in die Weltmetropole versetzte "Auslöschung", vollzogen in einer einzigen, wegwischenden Sprachbewegung.
Der New-York-Roman, den Thomas Bernhard nie geschrieben hat -, er stammt von dem 1980 geborenen Schriftsteller Joshua Cohen, der momentan als einer der interessantesten, avanciertesten Autoren der amerikanischen Gegenwartsliteratur gehandelt wird. Erstveröffentlicht wurde das Debüt im Original vor bereits knapp zehn Jahren (seither sind fünf weitere Bücher erschienen), nun liegt die deutsche Übersetzung vor.
Schneidermann, sein Leben und seine Weltsicht, lernt der Leser auf vermitteltem Wege kennen. In Cohens Roman spricht nur einer, nämlich der berühmte Geigenvirtuose Laster, und das über mehr als 500 Seiten hinweg. Der Ort seiner Rede: die Bühne der Carnegie Hall, auf der er, anstatt eine erwartete Kadenz zu improvisieren, zu einem nicht enden wollenden, bis ins Morgengrauen andauernden Monolog ansetzt. Sein Publikum: die versammelte New Yorker High Society, darunter seine Exfrauen, Anwälte, seine Proktologin.
Auslöser für Lasters Monolog ist das plötzliche Verschwinden Schneidermanns, seines alten Freundes, Weggefährten und Lehrers, während eines gemeinsamen Kinobesuchs. Es handelt sich um eine Schlüsselszene des Romans: Wie Schneidermann, der große Komponist und Holocaust-Überlebende, in eine Matinee-Aufführung von "Schindlers Liste" gerät und wie er miterleben muss, dass darin Bachs "Englische Suite" als Hintergrundmusik für ein grauenhaftes Nazi-Massaker verwendet wird. Nicht so sehr aus der filmindustriellen Ausbeutung des Holocausts, sondern aus der damit verbundenen Beschmutzung der Hochkultur ergibt sich für Schneidermann hier die Beleidigung - und der Grund dafür, den Kinosaal augenblicklich zu verlassen. "Kam nie mehr zurück", berichtet Laster nüchtern, "verschwand spurlos, verdünnisierte sich einfach, und weg war er, puff!"
Betrachtet man Schneidermanns Leben, so ist diese Reaktion nur verständlich. Das Letzte, was ihm, dem ungarisch-deutschen Juden, das mörderische 20. Jahrhundert gelassen hat, was er mit sich ins amerikanische Exil hat retten können - das war die Musik. Folglich wird ihre Herabwürdigung zum Soundtrack für den kinematographisch inszenierten Judenmord als Erniedrigung auch der eigenen Identität empfunden. Die besitzergreifende Verbindung von Hochkultur, Holocaust, Hollywood - für Schneidermann ist das einfach zu viel.
Der entschiedene Selbstentzug des Komponisten ist - das entwirft Cohen auf ebenso berührende wie hintergründige Weise - die äußerste Zuspitzung seiner überspannten Gegenwartsverachtung: Es kracht in diesem Roman gewaltig, nämlich eine tiefempfundene, mit der eigenen Persönlichkeit unlösbar verknüpfte Auffassung von ernster Kunst auf die "Shit-Hits des Monats", auf die "popmusikalischen Idioten", die sich unwissend und unverschämt an "Brahms- und Schubert-Resten" vergehen, so Laster im polemischen Geiste seines Lehrers.
Hinter solchen Angriffen, die von der Kunst und der Kultur beständig auf andere Lebensbereiche überschlagen, verbirgt sich also Liebe, und das geht mitunter bis zur Unkenntlichkeit. Eben daraus ergibt sich auch ein Problem: All den selbstgefällig-eloquenten Tiraden Schneidermanns, zum Beispiel über Homosexuelle, fällt über Hunderte Seiten hinweg niemand ins Wort. Dasselbe gilt für den, der hier spricht: Lasters verabscheuende Kommentare über Asiatinnen am Musikkonservatorium, über ihre angelernte Musikalität, ihre Körper, ihr feindliches Konkurrenzverhalten bleiben gänzlich unwidersprochen. Auch darin ist Cohens Roman der Suada bei Thomas Bernhard vergleichbar: in seiner zunächst provozierenden, irgendwann aber ermüdenden Einstimmigkeit.
Der hohe formale Aufwand, den Cohen treibt, indem er seinen Text typographisch einer Partitur annähert (bereits Lasters "Guten Abend" soll legato, mit einem Crescendo und "sehr trotzig" vorgetragen werden), ja auch der schiere Umfang seines Romans wirft Fragen auf. Im Dienste einer vielschichtigen Figurenentwicklung, eines verwickelten Handlungsverlaufs steht Cohens Versuch, literarisch "die Moderne zu wetzen", wie es an einer Stelle selbstbezüglich heißt, doch eher nicht.
Was vielmehr naheliegt: Cohen nutzt Scheidermanns Wut und Verbitterung, um das literarische Archiv einer untergehenden Welt zu schreiben. Es ist die Welt der modernen, jüdischen, europäischen Hochkultur, die hier in die Form einer gänzlich unzeitgemäßen, experimentellen Prosa gegossen wurde. Ihr charakteristisches Merkmal ist eine stakkatohafte Verdichtung von Namen, Orten, Begriffen, die den Leser wohl bewusst an den Rand der Überforderung bringen soll - eindrücklich etwa in Lasters Anmerkungen zur Pianisten-Dynastie der Schneidermanns: "ja, ich unterstelle Inzest nicht von Krafft-Ebings idealisierter Art, sondern schmutzige, schmutzige, schmutzige Ursprünge dieses Mystagogen (eines seiner Lieblingswörter, Schneidermann, er brachte viel Zeit über dem M im Webster's zu: Matrizid, Millionär, Moderne), dieser kunstvolle Mann, dessen Kunst nie versiegte, dieser synoptische Mann und seine synoptische Kunstreligion: eine Art Gesamtkunstwerk des Lebens, mit großem deutschen L angesichts aller Widerstände, versuchtem Genozid, Armut, die ganze Heimatlos-Nummer - wie bist du heute Abend denn drauf, Fremdzüngiger?"
Ja, wie ist dieser Laster eigentlich drauf? Ausgehend von seiner ausfallenden Bemerkung zu Schneidermanns Familie und zur Inzest-Theorie des Sexualpsychiaters Richard von Krafft-Ebing, wendet er sich sprunghaft Schneidermanns deutscher Kunstreligion und Wagners Gesamtkunstwerk zu, von wo aus er rasch auf die Pervertierung all dessen, auf Holocaust, Hunger und Vertreibung, zu sprechen kommt. All diese Aspekte einer "totalen europäischen Bildung" müssen hier offenbar festgehalten werden - für längere Ausführungen bleibt da keine Zeit. In tausend Funken scheint die Welt von gestern in dieser ausufernden Sprachkadenz noch einmal auf, bevor sie am Ende endgültig verglüht - und Laster seine Zuhörer ins Morgenrot entlässt: "ja, bald . . . bald . . . bald . . . oh die leuchtende Luft".
Ulrich Blumenbachs meisterhafte Übersetzung dieses schwierigen Romans, für die er eng mit dem Autor zusammengearbeitet hat (F.A.Z. vom 30. Juli 2016), ist nicht zuletzt als transatlantisches Phänomen zu betrachten: Joshua Cohen, der mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat (als Osteuropa-Korrespondent des "Jewish Daily Forward") und selbst Nachfahre ungarischer und deutscher Juden ist, hat uns den Schwanengesang der europäischen Moderne geschrieben.
KAI SINA.
Joshua Cohen: "Solo für Schneidermann". Roman.
Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrich Blumenbach. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2016. 536 S., geb., 26,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Dieses mit Philosophie, Religion, Musik und Kunst, europäischer Geschichte und amerikanischem Lifestyle durchsetzte, gleichermaßen kraftvolle wie gelehrige Prosafeuerwerk sprengt jedes Sprachkorsett.«Rolling Stone»Mit sinfonischer Sprachbravour erzählt Joshua Cohen in seinem Roman von der Freundschaft zweier Männer und der vernichtenden Kraft der europäischen Weltkriege.«Der Tagesspiegel»In seinem Debütroman entwirft Joshua Cohen, der als einer der originellsten Autoren der jungen Generation gilt, eine wilde Suada voller komischer Momente.«Radio Transglobal»Joshua Cohen (...) hat uns den Schwanengesang der europäischen Moderne geschrieben.«Kai Sina»Ein witziges, ein aberwitziges, ein emotional sehr starkes Buch.«Süddeutsche Zeitung»'Solo für Schneidermann' erzählt vom kulturellen Umbruch unserer Zeit, von der schleichenden Erosion der Gesellschaft in einer technologisch zunehmend beschleunigten Gegenwart.«Bayern 2»Vielstimmig geschrieben, wie eine Partitur.«taz»Der Text ist selbst ganz und gar Partitur, voller Triller und Fiorituren, voller satter Akkorde und zarter Pianissimos.«lustauflesen.de»Der Roman (...) entwickelt seinen eigenen Sog aus Sprachrausch mit einem Repertoire von Kalauer bis zur Philosophie.«Münchner Feuilleton»Ein beeindruckendes, vielschichtiges, sprachlich herausforderndes Debüt.«Bayern 2»Ein grandios komponiertes und urkomisches Feuerwerk der Sprache.«lustauflesen.de»Fulminante Prosa (...). Ein Glück für den Leser!«Radio Bremen»Ein rasender Ritt durch die europäisch-amerikanisch-jüdische Geschichte (...) ein Sperrfeuer gegen das behagliche Bildungsbürgertum (...) ein komplexer Kontertanz von Musik, Leben und Tod«Neue Zürcher Zeitung