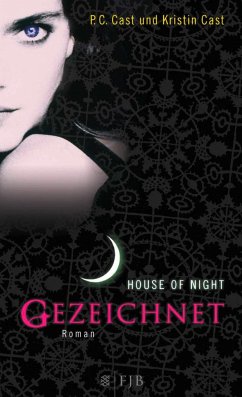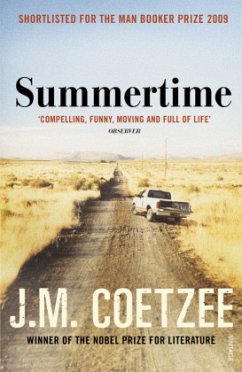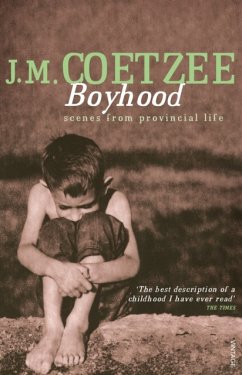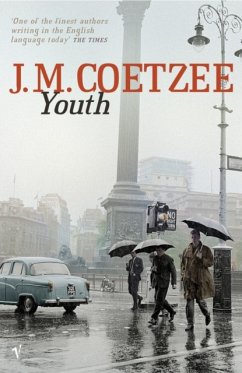Nicht lieferbar
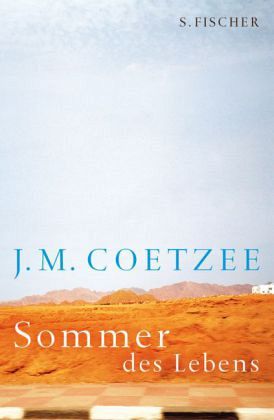
Sommer des Lebens
Roman. Ausgzeichnet mit dem Christina Stead Prize for Fiction 2010
Übersetzung: Böhnke, Reinhild
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Mit "Im Sommer" gewährt uns J. M. Coetzee überraschend Einblick in seine entscheidenden Lehrjahre als Schriftsteller. Aus Amerika zurückgekehrt, tuscheln die Verwandten hinter seinem Rücken: warum lebt er nur wieder hier in Südafrika bei seinem Vater und betoniert den Hof? Den Kopf voll Büchern und wilden Plänen, eine akademische Karriere, die nicht ins Laufen kommt, eine verheiratete Frau, die von dem rätselhaften Langhaarigen fasziniert ist, eine brasilianische Tänzerin, deren Tochter Nachhilfe braucht, schließlich die Cousine Margot und ein missglückter Ausflug ins Veld, der gro�...
Mit "Im Sommer" gewährt uns J. M. Coetzee überraschend Einblick in seine entscheidenden Lehrjahre als Schriftsteller. Aus Amerika zurückgekehrt, tuscheln die Verwandten hinter seinem Rücken: warum lebt er nur wieder hier in Südafrika bei seinem Vater und betoniert den Hof? Den Kopf voll Büchern und wilden Plänen, eine akademische Karriere, die nicht ins Laufen kommt, eine verheiratete Frau, die von dem rätselhaften Langhaarigen fasziniert ist, eine brasilianische Tänzerin, deren Tochter Nachhilfe braucht, schließlich die Cousine Margot und ein missglückter Ausflug ins Veld, der großen offenen Steppe, in der die Coetzee schon immer ihr Vieh hüteten.
Voller Ironie und Witz dreht Coetzee die Erzählperspektive um: nicht er schildert die Geschichte, sondern ein junger Autor, der ihn nie kennengelernt hat, aber nun an seiner Biographie schreibt. Um Stoff zu gewinnen, interviewt er die Frauen dieses Sommers. Auf seinem Tonband sammeln sich ungeschminkte Porträts eines Künstlers als junger Mann, der über sein eigenes Begehren stolpert, aber schließlich die Stimme findet, deren Unbestechlichkeit wir so bewundern.
Voller Ironie und Witz dreht Coetzee die Erzählperspektive um: nicht er schildert die Geschichte, sondern ein junger Autor, der ihn nie kennengelernt hat, aber nun an seiner Biographie schreibt. Um Stoff zu gewinnen, interviewt er die Frauen dieses Sommers. Auf seinem Tonband sammeln sich ungeschminkte Porträts eines Künstlers als junger Mann, der über sein eigenes Begehren stolpert, aber schließlich die Stimme findet, deren Unbestechlichkeit wir so bewundern.