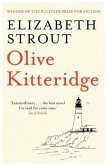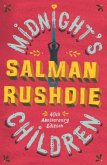Es scheint, als habe die Zeit das Haus am Rande Torontos übersehen. Und auch seine Bewohnerin, die seit Jahren immer seltsamer und vergeßlicher wird, lebt ganz im einsamen Rhythmus ihres dünner werdenden Gedächtnisses. Doch hat sich zwischen ihr und ihrem Sohn, der sie vor zwei Jahren als Teenager verließ, manches verändert. Jetzt ist er zurück und versucht nicht ohne Schuldgefühle, aber vor allem mit der Neugier des Spurensuchers, die verbliebenen Gedächtnissplitter der Mutter wieder zusammenzufügen. Wie erlebte sie ihre Kindheit in Trinidad, wie den Abschied von der Heimat und die Ankunft in der Fremde? Und worin besteht das Geheimnis, das ihre Existenz und auch seine eigene stets geprägt hat? Mehr und mehr beginnt er zu verstehen, daß auch seine Biographie auf dem Spiel steht. Die Erinnerung kehrt in ihrer beider Leben ein wie der Dämon aus den alten Geschichten der Karibik.
David Chariandy erzählt eindringlich, zuweilen drastisch und komisch. Mit seiner lebensnahen Anschaulichkeit und seiner frischen, von keiner Konvention stillgestellten Sprache hat dieser Roman über persönlichen und kulturellen Gedächtnisverlust bei den kanadischen Lesern begeisterten Zuspruch gefunden, und er wurde für den wichtigsten Buchpreis Kanadas, den Governor General's Literary Award, nominiert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
David Chariandy erzählt eindringlich, zuweilen drastisch und komisch. Mit seiner lebensnahen Anschaulichkeit und seiner frischen, von keiner Konvention stillgestellten Sprache hat dieser Roman über persönlichen und kulturellen Gedächtnisverlust bei den kanadischen Lesern begeisterten Zuspruch gefunden, und er wurde für den wichtigsten Buchpreis Kanadas, den Governor General's Literary Award, nominiert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein junger Mann kehrt zurück ins Haus seiner Kindheit: Der kanadische Schriftsteller David Chariandy erzählt eindrücklich vom Drama der Demenz.
Von Reinhard Helling
Die Gestalt des großen Rhetorikers Walter Jens wird David Chariandy nicht geläufig sein. Dafür ist die räumliche und sprachliche Distanz des 1969 als Sohn schwarzer und südasiatischer Einwanderer aus Trinidad in Toronto aufgewachsenen Autors zur Tübinger Gelehrtenrepublik wohl zu groß. Und doch hat der kanadische Schriftsteller, der zu den Mitbegründern eines auf schwarze kanadische Autoren spezialisierten Verlags gehört und in Vancouver englische Literatur unterrichtet, das perfekte Gegenstück zu Tilman Jens' heiß diskutiertem Buch "Demenz - Abschied von meinem Vater" geschrieben (F.A.Z. vom 23. Februar). Sein Debüt ist poetisch, neugierig, wahrhaftig und voller Mitgefühl.
Ginge es allein nach dem vordergründigen Inhalt, könnte Chariandys unter dem Titel "Soucouyant" 2007 in Kanada erschienenes Romandebüt auf Deutsch auch "Demenz - Abschied von meiner Mutter" heißen. Aber es geht um mehr. Adele, so der Name der in Trinidad geborenen Mutter des namenlosen Ich-Erzählers, kam wie ihr indischstämmiger Mann Roger vor dreißig Jahren nach Kanada. Da den Sohn die Suche nach den Gründen für das vorzeitige Abtauchen der Mutter aus dieser Welt direkt zur Erkundung der verlassenen Heimat führt, zur Inventarisierung der dortigen Gerüche und Aromen, Gebräuche und Aberglauben, trifft der Titel "Der karibische Dämon" die hier verhandelte Sache ganz gut.
Mit bewundernswertem Einfühlungsvermögen rückt der Autor der teuflischen Erscheinung präseniler Demenz und ihren unerfreulichen Auswirkungen zu Leibe. Der siebzehnjährige Erzähler war der Letzte der Familie, der sich aus dem Staub gemacht hat. Der Vater kam schon früh bei einem Arbeitsunfall ums Leben, der ältere Bruder hat sich ein Gegenleben im Dasein als Schriftsteller gesucht. Doch nun, nach zwei Jahren Abwesenheit, kehrt der Jüngste reumütig zurück in jene schmutzige Sackgasse in Scarborough am östlichen Rand der kanadischen Millionenstadt Toronto - dahinter nur die Klippen und die vorbeidonnernden Züge der Bahnlinie.
Sein Bericht von den denkwürdigen Zwischenfällen, die er mit seiner Mutter und der sie pflegenden Meera - auch sie eine schwarze Einwanderin - bis zu ihrem Tod erlebt, kommt nicht ohne Wutausbrüche, aber ganz ohne voyeuristische oder gar anklagende Elemente aus. Vielmehr ist es der Versuch, das von außen manchmal komisch wirkende Verhalten nachzuvollziehen. Was nicht einfach ist, wenn man hilflos dabei zusehen muss, wie die eigene Mutter Mehl auf dem Fußboden ausstreut, Eier mit Schale in den Mixer gibt, nackt auf die Straße geht und dort tanzt, in Mülleimern rumwühlt und an jedem Ort ihre Notdurft verrichtet.
"Sie ist alt geworden." Das war der erste Eindruck des Sohns. "Sie sieht zur Tür ihres Hauses hinaus und wirkt verwirrt von der Szenerie, dem zerquetschten Abendhimmel und dem Geraschel der Blätter im Krebsgang auf dem Küstenstreifen darunter." Kaum ist die Haustür geschlossen, offenbart sich ihm die ganze Ratlosigkeit, mit der seine Mutter auf das Eindringen eines ihr fremden Mannes in ihren vertraut gewordenen Zwei-Frauen-Haushalt reagiert. Er greift zu einem Trick und legt sein Knie mit dem walnussgroßen Wulst und der überspringenden Sehne frei. Beim Befühlen dieses Phänomens dämmert der Frau etwas Vertrautes: "Er starke Knochen. Drachensaat tief in Fleisch." Zaghaft versucht er, sich ihr zu erklären: "Dein Sohn . . ." Doch ihre Erinnerung liegt weiter zurück: "Großmutter von er auch. Knochen nicht zu ändern."
Während sich der junge Mann in dem Alltag zwischen verwüsteter Küche und geflutetem Bad nützlich zu machen versucht, reist er gedanklich nach Carenage, dem Herkunftsort der Mutter, zu den schwierigen Jahren des Beginns als schwarze Familie in Kanada, wo die Mutter erstmals das weiße Wunder Schnee erlebt, zu der finanziellen Not, den unwürdigen Arbeitsbedingungen und dem nicht besonders versteckten Rassismus der weißen Kanadier.
Die teilweise noch vorhandene Verbindung der Mutter zu ihrer Vergangenheit ist der einzige Anknüpfungspunkt für den zurückgekehrten Sohn. Als wäre ihr Gehirn völlig unbeeinträchtigt, nennt sie ihm neunundvierzig verschiedene Sorten Mango und schwärmt davon, wie köstlich Salzpflaumen schmecken.
Eine schöne Selbstbeschreibung dieses betörenden Buchs und seiner durchdachten Machart liefert der Autor selbst. An einer Stelle malt sich der Erzähler aus, wie es wäre, wenn er das erste Buch seines geflohenen Bruders zu sehen bekäme: "Ich würde es aufschlagen und zu lesen beginnen und sofort die Klarheit und Frische der Sprache bewundern, die Achtung vor einfachen, unverblümten Wörtern wie Regen, Stein, Spucke. Ich würde die Sorgfalt erkennen, die darauf verwendet wurde, die Welt mit den richtigen Wörtern zu benennen, und die Abneigung gegen jene Situationen, in denen die Sprache gefährlich überzuborden und aus dem Ruder zu geraten scheint." Mit besonderer Aufmerksamkeit dürfte Melanie Walz diese Sätze gelesen haben. In ihrer Übersetzung tauchen jedenfalls viele einfache, unverblümte Wörter auf.
War Toronto auf der literarischen Weltkarte bisher vor allem durch Michael Ondaatjes Roman "In der Haut eines Löwen" vertreten, so gerät die Millionenmetropole hier erneut ins Visier eines "internationalen Bastards", wie Ondaatje sich und andere Autoren beschrieb, deren Eltern in fernen Ländern geboren wurden und deren Hautfarbe deutlich kräftiger getönt ist als die des weißen Kanadiers.
Chariandys Debüt ist nicht zuletzt ein faszinierendes Dokument für die lebendige literarische Szene des Einwanderungslandes Kanada, das neben den vielen irischen und schottischen Abkömmlingen wie Alistair MacLeod, David R. MacDonald und Colin McAdam auch dem Inder Rohinton Mistry, dem Letten David Bezmozgis und dem Italiener Joe Fiorito eine Heimat gegeben hat. Und dem Mann aus Trinidad, der mit diesem Buch für ein knappes Dutzend Literaturpreise und Auszeichnungen nominiert war.
Bedauerlicherweise hat er keinen davon gewonnen. Aber vielleicht gelingt dies ja "Brother", Chariandys zweitem Roman, den der Traditionsverlag McClelland & Stewart veröffentlichen wird. Zu wünschen ist es ihm.
David Chariandy: "Der karibische Dämon". Roman. Aus dem Englischen von Melanie Walz. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009. 206 S., geb., 16,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main