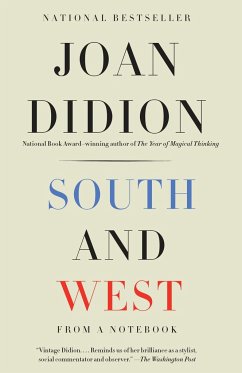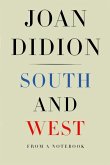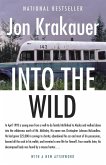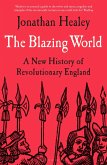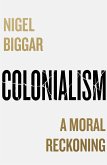National Bestseller One of the Best Books of the Year: NPR, Harper's Bazaar Joan Didion has always kept notebooks-of overheard dialogue, interviews, drafts of essays, copies of articles. South and West gives us two extended excerpts from notebooks she kept in the 1970s; read together, they form a piercing view of the American political and cultural landscape. "Notes on the South" traces a road trip that she and her husband, John Gregory Dunne, took through Louisiana, Mississippi, and Alabama. Her acute observations about the small towns they pass through, her interviews with local figures, and their preoccupation with race, class, and heritage suggest a South largely unchanged today. "California Notes" began as an assignment from Rolling Stone on the Patty Hearst trial. Though Didion never wrote the piece, the time she spent watching the trial in San Francisco triggered thoughts about the West and her own upbringing in Sacramento. Here we not only see Didion's signature irony and imagination in play, we're also granted an illuminating glimpse into her mind and process.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Neues von Joan Didion: Material einer Reportage aus dem amerikanischen Süden, die nie erschien
Arbeitsaufträge, direkt aus dem Himmel für Journalisten. Beziehungsweise aus den sehr guten Zeiten des 20. Jahrhunderts: "Eines Tages im Sommer 1970 bin ich nach Süden geflogen, habe mir ein Auto gemietet und bin ungefähr einen Monat lang damit in Louisiana und Mississippi und Alabama herumgefahren, habe mich mit keinen Offiziellen getroffen, habe keinen Termin abgedeckt, habe nichts gemacht außer, wie immer, herauszufinden, aus was sich das Bild zusammensetzt, das in meinem Kopf entsteht."
Joan Didion schreibt hier. Damals, im heißen Sommer 1970 von Louisiana, Mississippi und Alabama, dachte sie, da gäbe es eine Story, die sich aus diesem Bild in ihrem Kopf ergeben würde, die sie erzählen und dem Magazin "Life" verkaufen könnte, eine Reportage über den Süden der Vereinigten Staaten als psychogeographisches Zentrum des Kontinents, als historisches Reservoir eines ganzen Landes, das sein Heil in der Flucht nach vorn sucht, immer schon. So in etwa jedenfalls. Am Ende der vier Wochen fliegt Joan Didion von New Orleans dann wieder zurück nach San Francisco, letzter Satz der Reise: "Die Geschichte habe ich nie geschrieben."
Aber mitgeschrieben hat sie unterwegs - und diese Notizen von damals zu einem schmalen Buch geformt, das "South and West" heißt und jetzt auf Englisch erschienen ist, fünfzig Jahre später. Ein anekdotisches Buch, das im Ungefähren von Beobachtungen und Begegnungen schweben bleibt, aus denen Joan Didion etwas zu entwickeln hoffte. Im Grunde hält aber nur ihre unverwechselbare Stimme dieses Buch zusammen. Eine Stimme, nach der viele Leser süchtig sind, die zugleich aber fürchten, diese Stimme könnte bald verstummen, weswegen sie nicht genug von ihr kriegen können.
Joan Didion ist inzwischen zweiundachtzig Jahre alt. Sie hat in den vergangenen fünfzehn Jahren erst ihren Mann John Gregory Dunne und dann ihre Tochter Quintana verloren und über diese Schläge zwei unwiderstehlich traurige, innige Bücher geschrieben, die sie noch berühmter gemacht haben, als sie es bis dahin schon war. Joan Didion ist heute die Ikone des amerikanischen Journalismus, kleiner geht es nicht. Die ungefähr gleichaltrigen Silberrücken ihrer Branche - Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, Norman Mailer - leben nicht mehr oder zehren von einem Dominanzverhalten (Wolfe), das längst zur Pose erstarrt ist. Joan Didion hat zwar auch immer posiert, aber ihre Pose - klare, von der eigenen Unzulänglichkeit angewehte Prosa vor Sportwagen/Luxushotel/Strandhaus - hat den Wandel der Zeiten überstanden und wirkt bis heute emanzipatorisch. Was man dagegen mit dem sendungsbewussten Männerschweiß von Norman Mailer anfangen soll?
Und doch ist da etwas, was in den Notizen aus "South and West" deutlicher und deutlicher wird und all denen, die süchtig sind nach Didions ungefährem Sound, nicht gefallen dürfte. Wie privilegiert Joan Didion lebt, war zwar immer Teil ihrer autobiographischen Reportagen aus der amerikanischen Gegenwart, man konnte sich kaum retten vor hervorragenden Hotels und Restaurants und Hollywood-Schauspielerfreunden, Didion und ihr Mann haben ja beide fürs Kino geschrieben. Und mit diesen Privilegien hat Joan Didion auch nie kokettiert, die Koketterie entstand eher unfreiwillig durch das seltsame Gefühl, hier sei jemand unheilbar melancholisch in high places zu Hause, was ja letztlich auch wieder nur eine kleinbürgerliche Reaktion des Lesers ist. Jetzt, in den Notizen ihrer Reise durch den amerikanischen Süden, wo der Kampf um schwarze Bürgerrechte noch lange nicht ausgestanden ist, wirkt Didions privilegierter Blick auf die Verhältnisse aber unangenehm grell.
Sie hält es einfach nicht aus, diese Leute, ihre Traditionen, die Konföderiertenflagge der Sklavenhalter, die es sogar als Badetuch gibt. Gut essen kann man, egal wo, eigentlich immer nur im "Holiday Inn". Sie umfährt die größeren Städte aus Angst, dort sofort an den Flughafenschalter gehen zu müssen, um den Rückflug zu buchen. Aber wenn sie schon mal da ist, trifft sie natürlich die Weltstars der Gegend, den Fotografen Walker Percy und die Schriftstellerin Eudora Welty - wobei Joan Didion sie dann doch nicht trifft, weil sie in Jackson lebt und von dort Flüge nach New York und Kalifornien gehen.
In Guin, einer Stadt in Alabama, bestellt Joan Didion einen Eiskaffee in einem Diner, und als die Kellnerin zurückfragt, wie man den denn macht, sagt sie: "Wie Eistee." Darauf fragt die Kellnerin: "In einer Tasse?" Eine Seite später schaut sie den Jugendlichen von Guin zu: "Man schien gut und voller Hoffnung an diesem Ort leben zu können", schreibt sie, "und doch: Wenn die hübschen Mädchen von Guin hier blieben, landeten sie am Ende im Waschsalon von Winfield oder in einem Wohnwagen, wo die Klimaanlage die ganze Nacht läuft." Für die hässlichen Mädchen von Guin offenbar ein akzeptables Schicksal.
Joan Didion, das schöne Mädchen aus Sacramento, reist durch den Süden auf der Suche nach einem Geschichtsbewusstsein, das ihrer kalifornischen Heimat fehlt, weil es dort immer nur darum ging, abzureißen und neu anzufangen, der kürzere, westliche Teil dieses Notizbuchs spielt auch wieder dort. "Ich will nur wissen, was die Leute im Süden denken und tun", sagt sie einmal bei einem Abendessen in New Orleans - und hält dann Dinge fest, die einem bekannt vorkommen aus den Vereinigten Staaten von Trump: Zweifel an den Medien, weiße Statusangst, Autoaufkleber gegen die Evolution, unbewältigter Rassenhass, der Bürgerkrieg erst seit gestern vorbei, wenn überhaupt. "Leser von heute", schreibt der junge Schriftsteller Nathaniel Rich in seinem Vorwort, "werden betroffen oder sogar mit Schrecken feststellen, wie viel einem aus diesen lang verschollenen amerikanischen Porträts bekannt vorkommt. Didion sah ihre Ära klarer als jeder andere, was nur heißt, dass sie in die Zukunft sehen konnte." Ein geteiltes Land, wo die eine Hälfte die andere nicht versteht: Vielleicht ist es aber so, dass Joan Didions fremdelnder Text nicht die Erkenntnis dieser Teilung festhält, sondern vielmehr Ausdruck exakt dieser Teilung ist.
Aber auch dann wäre er ein Dokument. Und die skrupulöse Joan Didion, die ihre Texte bei jeder Überarbeitung von der ersten Zeile an neu schreibt, wird wissen, was sie hier aus der Hand gegeben hat: Beschreibungen eines Südens, der aus Sumpf und absackenden Friedhöfen gemacht ist, wie in "True Detective". Beschreibungen von Sonntagen, die so schrecklich sind, "dass man sich nach dem Montag sehnt". Und ein unnachahmliches Englisch von gestochen scharfer Melancholie. Deswegen einmal kurz Originalton, Joan Didion im Bikini, im Hotel an der Autobahn von New Orleans nach Norden: "Sitting by the pool at six o'clock I felt the euphoria of Interstate America: I could be in San Bernadino, or Phoenix, or outside Indianapolis." Für solche Melodien, verloren im Jetzt, liebt man diese Stimme.
TOBIAS RÜTHER
Joan Didion, "South and West. From a Notebook". Verlag Knopf, 160 Seiten, um 15 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main