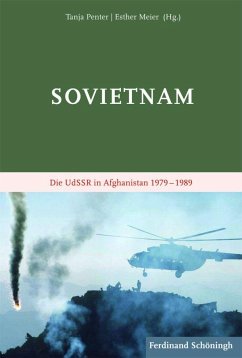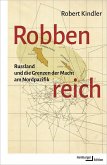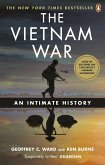Der sowjetisch-afghanische Krieg war einer der blutigsten Konflikte des Kalten Krieges. Afghanistan wurde nicht nur zum Schlachtfeld der sowjetisch-amerikanischen Systemkonkurrenz, sondern war auch ein Ort der mehr oder minder gewaltsamen Begegnung zwischen »modernen« Sowjets und »rückständigen« Afghanen.Die Autorinnen und Autoren greifen die wechselseitigen Wahrnehmungen und Kriegserfahrungen auf und spüren den Folgen des Konflikts für Staat und Gesellschaften in beiden Ländern nach. Sie dekonstruieren Mythen, die sich bis heute um den Konflikt ranken, und betrachten das spannungsvolle Verhältnis zwischen der offiziellen Geschichtspolitik in Russland und den Erinnerungen der - oftmals traumatisierten - Veteranen an diesen unpopulären Krieg.Nach einer kurzen Phase der Öffnung der russischen Archive in den 1990er Jahren ist die zentrale Überlieferung zum sowjetischen Afghanistankrieg in Putins Russland wieder unter Verschluss. Die Beiträge erschließen jedoch bislang vernachlässigte Quellenbestände wie Internetforen, Interviews, Bildquellen, Lieder und Memoiren. Dabei wird auch gefragt, welches Potential diese Quellentypen haben und mit welchen methodischen Herausforderungen ihre Erschließung verbunden ist.

Das Debakel der sowjetischen Intervention in Afghanistan 1979 bis 1989
Darauf war die Welt nicht vorbereitet. Als die sowjetische Armee am 24. Dezember 1979 die Grenze zu Afghanistan überschritt, läutete sie nicht nur das Ende der Entspannungspolitik der siebziger Jahre, sondern auch den Exitus der Sowjetunion ein. Ursprünglich als schnelle und begrenzte Operation geplant, entwickelte sich der Afghanistan-Krieg nämlich bald zu einem ressourcen- und kräftezehrenden Debakel, von dem sich die ohnehin wankende östliche Vormacht nie mehr erholte.
Insgesamt waren bis Februar 1989 620 000 sowjetische Soldaten im Einsatz. Mindestens 15 000 Mann kamen ums Leben, über 70 Prozent wurden verwundet, erkrankten schwer oder wurden traumatisiert. Von den rund 15 Millionen Bewohnern Afghanistans wurden mehr als eine Million getötet, ungezählte verletzt und jeder zweite in die Flucht getrieben. Und weil sich diese Tragödie vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielte, verloren die Sowjets auch in der sogenannten Dritten Welt, also in den Reihen ihrer potentiellen Sympathisanten und Unterstützer, rasant an Ansehen.
Das alles erinnerte schon die Zeitgenossen sehr an das Debakel, das die Amerikaner von 1965 bis 1975 in Vietnam erlebt hatten. Obgleich deren Einsatz dort noch ungleich massiver und ihre eigenen Verluste deutlich höher waren als die sowjetischen an den Hängen des Hindukuschs, gingen die Vereinigten Staaten zwar aus diesem Krieg vielfach geschwächt hervor, aber ihr militärisches und vor allem ihr wirtschaftliches Fundament waren nach dem Waffenstillstand des Januars 1973 nicht nachhaltig angegriffen oder gar zerstört. Das unterschied Vietnam von "Sovietnam".
Insoweit der von Tanja Penter und Esther Meier herausgegebene Band mit seinem originellen Titel einen Vergleich dieser beiden Kriege suggeriert, führt er in die Irre. Tatsächlich geht es ausschließlich um die sowjetische Intervention in Afghanistan und insbesondere um Antworten auf die Frage, wie man in Afghanistan und vor allem in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis heute mit dieser Katastrophe umgeht. Das ist ein spannendes und sehr ergiebiges Forschungsfeld. Die Herausgeberinnen haben die 13 Beiträge, die zum Teil auf eine wissenschaftliche Tagung an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität zurückgehen, drei großen Fragestellungen zugeordnet: Gewalterfahrungen im Krieg, Kampf um Anerkennung nach dem Krieg, Erinnerungen an den Krieg. Rückblicke in die Vorgeschichte und Analysen der "Deutungen und Lehren" runden das Ganze ab.
Die Stärke des Bandes besteht in seinen ungewöhnlichen Fragestellungen, auch wenn die entsprechenden Beiträge mit dem eigentlichen Thema mitunter nur bedingt zu tun haben. So zeigt Elke Beyer in ihrer Studie über "sowjetische, afghanische und westliche Experten bei der Stadtplanung in Kabul in den 1960er Jahren", dass sowjetische und amerikanische Fachleute während des Kalten Krieges auf diesem Gebiet bemerkenswert erfolgreich zusammenarbeiteten und dass die Sowjets dabei häufig die Noten setzten. So schuf der 1964 aufgestellte "Generalplan für Kabul" mit den "Wohnvierteln sowjetischen Typs ... durch und durch moderne Nachbarschaften". Zugleich erinnern diese und andere Beispiele sowjetischer Entwicklungshilfe auch daran, dass das sowjetische Engagement in der "Dritten Welt" nicht nur eine militärische Dimension hatte.
Aber natürlich stand sie in Afghanistan spätestens seit 1979 im Vordergrund. Die Brutalität, die beide Seiten an den Tag legten, führte nicht nur dazu, dass die Erinnerungen an das lange Zeit gute sowjetisch-afghanische Verhältnis verblassten. Vielmehr hatten die vielfältigen gemeinsamen Erfahrungen gegnerischer Gewalt auch zur Folge, dass die beiden Kriegsparteien ihre zum Teil erheblichen inneren Gegensätze jedenfalls zeitweilig überbrückten. Das galt vor allem, wie Rob Johnson zeigt, für die im Westen mitunter wider besseres Wissen zu Helden stilisierten Mudschahedin.
Es galt aber auch für die sowjetischen Truppen. Markus Balázs Göransson erinnert daran, dass in deren Reihen auch 100 000 Soldaten aus den zentralasiatischen Sowjetrepubliken kämpften, darunter muslimische Tadschiken, von denen auch bis zu drei Millionen in Afghanistan lebten. Tatsächlich zogen aber die "allgegenwärtigen Gefahren des Krieges ... eine klare Grenze": Den sowjetischen Tadschiken waren ihre Kameraden in jeder Hinsicht näher als die ethnisch und religiös verwandten Afghanen. Das überrascht auch deshalb, weil die Wehrpflichtigen, also das Gros der sowjetischen Soldaten, Gewalt zuerst und vor allem in den eigenen Reihen erlebten. Natalyia Danilova, die sich wie viele Mitautoren vor allem auf Zeitzeugenberichte stützt, zitiert einen von ihnen so: "Ich ging als normaler Mensch in die Armee, kam aber völlig zerstört, gebrochen und zugrunde gerichtet zurück."
Man ahnt, wo viele Konfliktlinien in den Nachfolgegesellschaften der Sowjetunion ihre Wurzeln haben. Und man ahnt auch, warum die russische Führung seit geraumer Zeit versucht, den Krieg in Afghanistan als frühen Widerstand gegen den islamischen Fundamentalismus zu deuten und warum sie das Denkmal für die dort Gefallenen am Zentralen Moskauer Gedächtnisort für den Zweiten Weltkrieg errichten ließ. Die Heroisierung des sowjetischen Militärs ist mehr als eine monumentale historische Reminiszenz.
GREGOR SCHÖLLGEN
Tanja Penter/ Esther Meier (Herausgeber): Sovietnam. Die UdSSR in Afghanistan 1979-1989. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2017. 371 S., 59,-[Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main