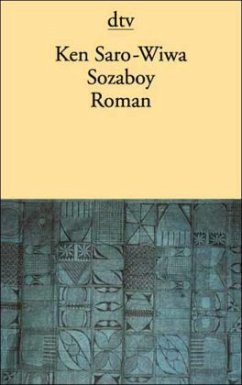Sozaboy nennen sie ihn - den Jungen, der unbedingt in den Krieg will. Auch wenn keiner so genau weiß, gegen wen man kämpft und wo geschweige denn, warum. Die Uniform ist es, die ihn lockt - so kann er Eindruck machen im Dorf und bei seiner Frau Agnes. Sozaboy erlebt Dinge, die sein Fassungsvermögen übersteigen, schreckliche, unbegreifliche oder einfach nur verwirrende Dinge.
Sein Schicksal in der Armee ist kein glückliches, es führt immer weiter abwärts: Langeweile, Aufbegehren, Bestrafung, Kampf und Gefangennahme. Am Ende ist sein Leben fast ruiniert, sein Dorf zerstört, seine Familie getötet, seine Chancen gering. Doch trotz aller Rückschläge, Scham und Demütigung, verlassen ihn seine Lebenslust, seine naive Energie nie ganz.
Sein Schicksal in der Armee ist kein glückliches, es führt immer weiter abwärts: Langeweile, Aufbegehren, Bestrafung, Kampf und Gefangennahme. Am Ende ist sein Leben fast ruiniert, sein Dorf zerstört, seine Familie getötet, seine Chancen gering. Doch trotz aller Rückschläge, Scham und Demütigung, verlassen ihn seine Lebenslust, seine naive Energie nie ganz.

Eine Kampfschrift: Ken Saro-Wiwas eindringlicher "Sozaboy"
Es gehört zum Vokabular des Beschreibens von Romanen, von Helden zu sprechen, die also durch ihr Leben ziehen wie durch eine Schlacht. Diese der Sage entlehnte Ausdrucksweise wurde schon vom ersten großen Roman persifliert: Don Quijote suchte Schlachten da, wo keine zu schlagen waren, war ein Ritter ohne Mission. Wenn sich das Genre des Romans aber dem eigentlichen Habitat der Helden zuwendet, dem Krieg, werden diese Kreaturen rar; von Grimmelshausen bis Remarque und Hasek sind die Werke, die diese Gattung definiert haben, von Antihelden bevölkert, von Menschen, die im allgemeinen in Schlachten nichts Heroisches sehen können und daher versuchen, sich einen eigenen Lebensraum inmitten des Todes zu schaffen.
Eine afrikanische Addition zu diesem Kanon ist Ken Saro-Wiwas 1985 in Nigeria publizierter Roman "Sozaboy", der jetzt auf deutsch vorliegt. Die Lektüre im europäischen Kontext ist legitim, denn Saro-Wiwa, als Intellektueller in einer ehemaligen britischen Kolonie, hat für sein politisches Engagement eine europäische Form, den Roman, und eine europäische Sprache, nämlich das Englische, gewählt. Er selbst beschloß, in seinem Heimatland zu bleiben; dort ließ ihn die von ihm beschriebene und bekämpfte Diktatur nach einem Scheinprozeß 1995 hinrichten.
"Sozaboy" ist nicht Unterhaltung oder Selbstsuche, sondern eine Lehr- und Kampfschrift, deren aufklärerische Absicht offen zutage liegt. Mene, der "Held", ist Lastwagenfahrerlehrling in seinem Dorf in einem ungenannten afrikanischen Land, hinter dem sich unschwer Nigeria erkennen läßt. Sein Chef macht Profit aus dem Transport von Flüchtlingen, und er selbst macht sich keine Gedanken über die Ursachen dieses Menschenstroms, beobachtet aber, wie sich auch im Dorf die Situation zusehends verändert und daß überall Palava zu sein scheint, Ärger. Die Anfänge dieser Veränderung in dieser von politischer Rhetorik beherrschten Welt sind klein: "Das Radio hat gebrüllt wie noch nie. Große Worte, lange Sätze, Grammatik. Die ganze Zeit."
Bald schon merkt Mene, daß nur die immer häufiger auftauchenden Soldaten wirklich Respekt genießen, daß sogar der Chief des Dorfes vor ihnen Angst hat und daß auch seine Freundin ihn in Uniform sehen will. Also beschließt er, zur Armee zu gehen. Als "soldier boy", Sozaboy im örtlichen Dialekt, fällt der Abglanz des Soldatentums auf ihn, sobald er seine Absicht bekanntgibt; er heiratet und ist jetzt ein Mann. Der tumbe Tor begibt sich zur nächsten Rekrutenstelle. Was folgt, ist eine Litanei des Leidens, Mordens, Folterns und Zerstörens, in der er in die Armee eintritt, von der Front flieht, gefangen und gefoltert wird, der gegnerischen Armee dient, wieder flieht, in sein inzwischen zerstörtes Heimatdorf zurückkehrt. Getrieben vom überwältigenden Verlangen, Frau und Mutter wiederzusehen, sucht er die Flüchtlingslager ab und muß endlich begreifen, daß er, der selbst niemals einen Schuß abgegeben hat, alles verloren hat an einen Krieg, dessen Zweck ihm niemals erklärt wurde.
Eine Schlüsselfigur ist der vom Übersetzer mit Anklang an Brecht benannte Erstkommtsfressen, den Sozaboy in den verschiedensten Situationen wiederzuerkennen glaubt, die Inkarnation des Opportunisten, der foltert und verrät, dann wieder heilt oder tötet und auch sonst alles tut, was die Situation von ihm verlangt.
"Nur Gott weiß, was Erstkommtsfressen an dem Tag mit mir gemacht hat. Als er mit der Koboko (Peitsche) fertig war, habe ich überall geblutet. Ich habe gebetet, ich will sterben. . . . Danach haben sie meine ganzen Haare abrasiert, und dann haben sie mich in eine kleine Hütte gesperrt. Wir waren viele in der Hütte. Und die ganze Zeit, die wir da drin waren, haben wir kein Essen gekriegt. Nur ein bißchen Wasser. Und man konnte auch nicht rausgehen, wenn man mal mußte. Alle haben in diesen kleinen vollgeschissenen Knast gepißt und gekackt. Ich habe mich gefragt, warum hab' ich bloß meiner Mama nicht gehorcht? Warum bin ich bloß zur Armee gegangen?"
Die in der Naivität der Erzählerperspektive begründete scheinbar Armut der Sprache und die sorgfältig konstruierte Primitivität von Diktion und Aufbau dieses afrikanischen Simplizissimus sind schlüsselhaft sowohl für die Eindringlichkeit dieses Werkes, in dem Unaussprechliches gar nicht erst in ungenügende Worte gekleidet wird, sondern sich der Wahnsinn und das Leiden dem Leser erst allmählich in der eigenen Imagination erschließen.
Die Schwäche des Textes ist der didaktische Unterton, der in dieser Parabel manchmal die Oberhand gewinnt und sich zweifellos aus der angesprochenen Leserschaft erklärt. Auch die gnadenlose Einfalt des Ich-Erzählers kann irritieren. Das eigentliche Problem der deutschen Ausgabe aber liegt in den fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der Übersetzung. Wie Gerhard Grotjahn-Pape, der die Übertragung besorgte, in seinem Nachwort selbst feststellt, findet Saro-Wiwas "rotten English" - eine Mischung aus "nigerianischem Pidgin-Englisch, gebrochenem Englisch und gelegentlichem Aufflackern von gutem Englisch" - kein direktes Äquivalent im Deutschen. Die hier gesuchte Lösung, Mene sprechen zu lassen, "wie eben ein junger, nicht besonders gebildeter Mann so redet", kann letztendlich nicht überzeugen, weil das Idiom des Buches synthetisch bleibt und die sprachlichen Register nicht zusammenpassen. Dies ist weniger ein Vorwurf an den Übersetzer als eine Anerkennung der Unmöglichkeit, dies einzigartige idiomatische Geflecht in einer anderen Sprache wiederauferstehen zu lassen.
"Translation is at best an echo", sagte George Borrow. In der vorliegenden Übertragung läßt sich ein eindringlicher und ungekünstelter Roman heraushören, der dem Kanon der Antikriegsliteratur eine wichtige Stimme hinzugefügt hat. PHILIPP BLOM
Ken Saro-Wiwa: "Sozaboy". Roman. Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Gerhard Grotjahn-Pape. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1997. 267 S., br., 19,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main