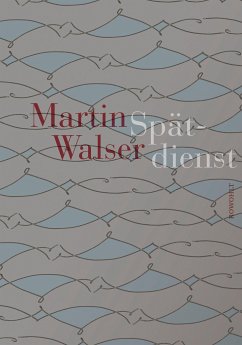"Das Alter ist ein Zwergenstaat, regiert von jungen Riesen." Wer sagt das? Ein lyrisches Ich zwischen Glücksmomenten und Schwärze, Leere, Sturz. Beim Durchkämmen des Hundefells, beim Aufschneiden eines Apfels oder immer dann, wenn die Berge im Blau stehen, der Wind in den Bäumen rauscht, die Blätterschönheit den Atem raubt, kommt sie auf, die Frage, ob das das Glück sei, denn lange währt es nie. Schon fährt etwas dazwischen, Wörter, die wehtun, ausgesprochen von anderen, gegen die nur eines hilft: "Sich in Verse hüllen, als wären es Schutzgewänder, schön, weltabweisend, die Einbildung heißt Aufenthalt." In Martin Walsers neuem Buch finden sich Lebensstenogramme, mal sind sie lyrisch, mal essayistisch, immer aber berührend, tief empfunden, wahr.

Zu Martin Walsers neuem Buch "Spätdienst"
Wie soll man mit dem Alterswerk des jetzt einundneunzigjährigen Martin Walsers umgehen: jedes einzelne Wort abwägend, wie man es von einer Literaturkritik erwarten darf? Oder, wie es die Literaturkritikerin Iris Radisch ihrem Metier zum Vorwurf gemacht hat, großzügig, mit dem weiten Blick auf die zweifelsohne große Bedeutung dieses Autors? Eine Frage, die im Hinblick auf immer ausgedehntere Schreibkarrieren nicht nur Walsers literarische Arbeiten betrifft. Tatsächlich geht es hier nur um eine einzige schmale Passage aus Walsers neuem Buch "Spätdienst - Bekenntnis und Stimmung". Dort heißt es in der ungewöhnlichen satztechnischen Form, in der das ganze Buch gehalten ist:
"Ostern, schönes Feuilleton
Aus Blut und Blüte,
du, das feiern wir!
Statt Golgatha, Verdun und Auschwitz
lassen wir diesmal holzschnitthaft Hué herkommen
und sagen keinem hierzulande nach,
dass er diesen Krieg andauernd billigt,
sagen das nicht der CDU nach,
die diesen Krieg andauernd billigt,
sagen das nicht der SPD nach,
die diesen Krieg andauernd billigt."
Das Problematische dieser Zeilen besteht - soll man im Fall von Martin Walser sagen "abermals"? - darin, wie hier Auschwitz thematisiert wird. Die Passage suggeriert, dass Auschwitz unter verschiedenen Ereignissen einzureihen sei. Neben Jesu Kreuzigung auf Golgatha, der Schlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg und ebendem Kampf um die Stadt Hué im Vietnam-Krieg erscheint Auschwitz in dieser Formulierung als eine tödliche Katastrophe unter vielen. Die Phrase "lassen wir diesmal holzschnitthaft Hué herkommen" legt zudem nahe - als würde man im Karteikasten blättern -, dass sich diese Ereignisse jederzeit heranzitieren ließen und damit letztlich auch austauschen: Diesmal lässt man Hué herkommen, ein anderes Mal kann es ebenso gut Golgatha, Verdun oder Auschwitz sein.
Auschwitz aber ist kein Phänomen, das man in eine Anadiplose einreihen kann. Es ist kein historisches Ereignis, das man auf Knopfdruck herkommen lässt oder wieder abbestellt, wenn es einem gerade nicht passt. Auch nicht, wenn dies nur in einem einzelnen Satz innerhalb eines Buchs geschieht. Und selbst dann nicht, wenn es sich - wie die für die Umschlagrückseite gewählte Bezeichnung "Lebensstenogramme" nahelegt - um ein historisches Notat etwa aus dem Jahr 1968 handeln sollte, als in Hué von amerikanischen Truppen ein Massaker verübt wurde und CDU und SPD als erste Große Koalition in Bonn regierten. Denn weder musste man das damals schreiben, noch ist jemand dazu gezwungen, diese Formulierung fünfzig Jahre später zu wiederholen.
Dass Walser die Schoa dann auch noch ausgerechnet unter dem Überbegriff eines zu "feiernden Osterns" abhandelt, fügt der dumpfen Geschichtsrevision noch eine traurige Pointe hinzu: Der Massenmord an Juden soll eine ebensolche Engführung von Blut und Blüte sein, wie es die Ostererzählung des Christentums sei? Aufbruch und Vergehen in einem? Zumal dieser Konstruktion von vermeintlichen Gleichgewichten gleichzeitig ein altbekannter antisemitischer Topos unterliegt: als hätten auf der einen Seite die Juden ebenden christlichen Gottessohn ermordet, was auf der anderen Seite vermeintlich durch massenhaften Mord der Juden durch die Christen ausgeglichen worden sei. Was für ein abscheuliches Phantasma einer vermeintlichen historischen Gerechtigkeit.
Damit man als Leser genau weiß, wie es um einen steht, die besagte Aufzählung gleich danach mit der wiederholten, noch zugespitzten Aussage weiter:
"wir feiern vielmehr
feierlich statt
Golgatha, Verdun und Auschwitz
diesmal Hué."
Da steht selbstverständlich nicht wörtlich, dass jemand Auschwitz feiern würde. Sondern dass dieses "wir" ja Hué feiere, während auf alle anderen potentiellen Feierlichkeiten eben nur angespielt wird. Weil es eben schon reicht, dass sie ein andermal gefeiert werden könnten. So geht Provokation mit eingebautem Notausgang, durch den man sich jederzeit wieder zurückziehen kann: "Aber das habe ich doch gar nicht gesagt!" Nein, nur suggeriert. Aber so sophisticated ist die Aussage auch wieder nicht. Es ist schon klar, was in den Anspielungsraum eingeschleust wird.
Ist das zu streng gelesen? Von außen in den Text hineingetragen? Dann müsste sich allerdings eine harmlose Lesart dieser Passage entwickeln lassen. Die entfaltet sich aber nicht. Nimmt man jedes Wort der zitierten Textstelle ernst, gibt es hinter den Eindruck kein Zurück: Walser relativiert und bagatellisiert an dieser Stelle Auschwitz. Und es fällt extrem schwer, ernsthaft behaupten zu wollen, dass dies dem Autor einfach so unterläuft. Denn Walser fügt sich mit diesem "Bekenntnis" (so ja das im Untertitel ausgewiesene Genre) in den direkten Zusammenhang mit seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an, in der er 1998 mit seiner Formulierung von der "Geißel Auschwitz" exakt jener Relativierung und Verharmlosung der Schoa das Wort redete, um sich dann darauf zurückzuziehen, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe. Walser und sein Verlag wissen um die Position des Schriftstellers im historischen Diskurs. Sie sind sich bewusst, welche Debatte er mit seiner damaligen Rede ausgelöst und für welche Positionen er als Legitimationsfigur gedient hat und weiterhin dient. Mit dieser persönlichen Geschichte unterläuft einem Autor seines Formats eine solche Textstelle nicht.
Nun könnte man argumentieren: Diese Aussage kommt ja nur an einer einzigen Stelle vor und bleibt innerhalb des gesamten Buchs eine Marginalie. Vom Umfang her gesehen, stimmt das. Auf den noch folgenden 190 Seiten folgt kein Wort dieser Art mehr. Wenn man auch manche krude Kritikerbeschimpfung und eine Reihe toxischer Sätze wie: "Gräber bringen Glück" oder "wie leicht ist es, einen Mann zu vergewaltigen. Man liegt da, rührt sich nicht, wünscht sich weg, stellt sich tot, es nützt nichts" über sich ergehen lassen muss. Selbstverständlich ließe sich in einer üblichen Rezension einiges über die literarische Form der "Lebensstenogramme" und deren chaotische Ordnung sagen, und sicherlich könnte man auch die topischen Eigenschaften des Alterswerks in Anschlag bringen, jene Inszenierung des Schwellendaseins zwischen Leben und Tod, die ihren Fokus auf basale Empfindungen und mitunter heftige Gefühls- und Gedankenausbrüche legt. Das mag alles zur Form dieses Schreibens gehören.
Aber dennoch würde man, wenn man diese Aspekte in Betracht ziehen und eine Auseinandersetzung mit dezidiert literaturkritischen Kriterien beginnen würde, die Prioritäten auf den Kopf stellen. Oder anders gesagt: Es gehört zum Kalkül dieses Textes, dass er seine Leser und vor allem seine professionellen Kritiker, die in diesem Buch immer wieder direkt angesprochen werden, vor eine Entscheidung stellt: Na, überliest du den Kommentar geflissentlich, um dich auf den Rest des Buches zu fokussieren? Musst du, zumal als Literaturkritiker, nicht über Stenogrammstil und literarische Selbstentblößung schreiben, bevor du die Passage über Auschwitz vielleicht irgendwo als Randphänomen erwähnst? Entweder hat man sich zum Komplizen gemacht: Einmal nur Auschwitz-Relativierung ist ja gar nicht schlimm. Oder verbeißt man sich als Literaturkritiker etwa an dieser einen Stelle? Dann ist einem das Literarische wohl nicht so viel wert? Dann hat man sich mal wieder - Kritiker sind so ausrechenbar - für die mediale Erregung und den Skandalruf entschieden. In Folge ist man also nur einer dieser überdrehten Schreihälse, die Literarisches nicht Literatur sein lassen können.
Martin Walser stellt seinem Buch zwei Widmungen voran, die eine Unterscheidung einführen. Das Buch sei, so die geschürte Erwartung, "für Gegner: ein gefundenes Fressen. Für meine Leser: vielleicht ein Ausflug ins Vertraute". Im Anschluss an diese gesetzte Opposition muss man das Selbstverständliche wiederholen: Diese Überlegungen hier kommen nicht aufgrund einer vorab bestehenden Gegnerschaft zustande, sondern beruhen auf einer Lektüre, die weder erst mit diesem Band einsetzt noch nach dreizehn Seiten an der besagten Textstelle abgebrochen wäre.
Und es geht ausdrücklich nicht darum, Martin Walser zum Opfer einer Medienkampagne zu machen. Auch diese Konstellation nimmt Walsers "Spätdienst" scheinbar vorweg. Inszeniert der Band doch mit reichlicher Lust an Drastik eine Figur des Autors, die vom "Mediengewimmel" hingerichtet wurde:
"Zerquetscht wie andere Wesen liege ich auf der Bahn,
Innereien leuchten lächerlich zum Himmel,
ins Licht steht ein geborstener Zahn,
ich grüße die Töter, das Mediengewimmel!"
Es geht hier nicht darum - wie es das Bild imaginiert -, einen renommierten Autor wie eine Beute zu jagen. Das Anliegen lautet schlicht: eine klare Position deutlich zu machen. Und die Frage ernst zu nehmen, ob in einem Alterswerk nicht mehr jedes Wort von Gewicht sei. Wie lässt sich angemessen mit dem "Spätdienst" eines renommierten Autors umgehen, wenn er seine Leser bei genauer Lektüre provokativ mit der Bagatellisierung von Auschwitz konfrontiert? Zumal, wenn dieses Buch von Seiten des Verlags als "die Summe, ja das Resultat der Poetik Martin Walsers" präsentiert wird.
CHRISTIAN METZ
Martin Walser: "Spätdienst". Bekenntnis und Stimmung.
Mit Arabesken von Alissa Walser. Rowohlt Verlag, Reinbek 2018. 207 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Arno Widmann geht gerne den Walserweg. Wenn Martin Walser sich selbst und uns wieder einmal an der Verfertigung der Gedanken beim Schreiben teilnehmen lässt, ist das laut Widmann zwar nicht immer stubenrein, aber erkenntnisfördernd allemal. Walsers Notizen, Einfälle, Beobachtungen überraschen den Rezensenten ein ums andere Mal, nicht nur was das Bild des Autors angeht. Lustvoll findet er die Schreib- und Denkbewegung, sogar das Herfallen über Kollegen, das Ungenierte. Für Widmann ist das Buch ein Triumph, weil es zeigt, wie das Wünschen sich in den Text verwandelt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Ein Triumph gegenüber dem bloßen Wünschen. Arno Widmann Frankfurter Rundschau 20181120