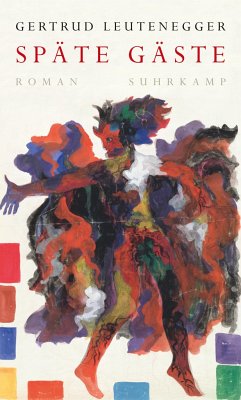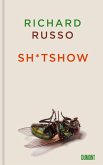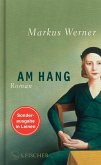Ein Dorf nahe der italienischen Grenze. Spät am Abend ist die Erzählerin nach einer Todesnachricht dort eingetroffen. Orion ist gestorben, mit dem sie viele Jahre ihres Lebens geteilt hat, ehe sie mit dem Kind die Flucht ergriff. Sie will die Nacht vor der Totenmesse im Wirtshaus am Waldrand zubringen, einer ehemals herrschaftlichen Villa. Doch diese ist wie ausgestorben, der sizilianische Wirt verreist, die Wirtschafterin wie jedes Jahr zur Fasnacht im Ort jenseits der Grenze, wo sich die Dorfbewohner als »Schöne und Hässliche« verkleiden. Zwar findet sie Zuflucht im unverschlossenen Gartensaal, wo sie früher oft zusammengesessen haben. Doch aufgestört von beunruhigenden Berichten aus dem benachbarten Tal, bedrängt von Erinnerungen an Orion und von Bildern aus der Kindheit, gerät die Erzählerin in einen zwischen Nachtwache und Schlaf oszillierenden Zustand. Nicht nur Szenen aus der Vergangenheit suchen sie heim, gegen Morgen tauchen auch maskierte Gestalten auf, die sie zugleich erschrecken und anziehen.
Auswandern und Vertriebensein, Verlust und Wiedergewinn, Trauer und das Irrlichtern während der Fasnachtszeit verbinden sich in Gertrud Leuteneggers Roman zu einer traumwandlerischen Gegenwart, »als würde alles, ein wenig nur von der Wirklichkeit verrückt, noch einmal neu gesehen werden können« Ulrich Rüdenauer, Der Tagesspiegel.
Auswandern und Vertriebensein, Verlust und Wiedergewinn, Trauer und das Irrlichtern während der Fasnachtszeit verbinden sich in Gertrud Leuteneggers Roman zu einer traumwandlerischen Gegenwart, »als würde alles, ein wenig nur von der Wirklichkeit verrückt, noch einmal neu gesehen werden können« Ulrich Rüdenauer, Der Tagesspiegel.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Hilmar Klute scheint verzaubert von Gertrud Leuteneggers Roman um eine Frau, die mit ihrer Tochter zur Beerdigung ihres Ex-Mannes in ein Tessiner Dorf zurückkehrt und dort von allerhand Erinnerungen heimgesucht wird. Für Klute hat dieses im Innern der Erzählerin ablaufende, durch Deckenfresken oder Betrunkene in den Gassen ausgelöste Erinnerungstheater durchaus etwas mit uns Menschen im Lockdown zu tun. Stark findet er zudem die Sprache im Erzählstrom, die Lichtmotivik und Leuteneggers Art, Figuren "gegeneinander spielen" zu lassen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Gertrud Leutenegger leuchtet mit ihrer so kühnen und schönen Sprache, mit raffinierten Überblendungen und bald filmischen Sequenzen das ganze Angsttheater unserer Gegenwart aus.« Hilmar Klute Süddeutsche Zeitung 20210302