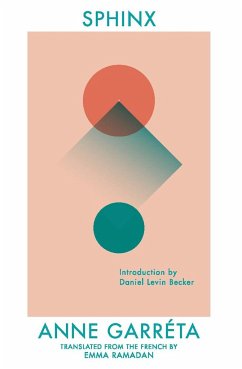Der Oulipo-Roman "Sphinx" von Anne Garréta ist ein atemberaubend kühner Versuch, das Unsagbare der Liebe ohne Angst auszusprechen.
Von Dietmar Dath
Liebe schaut und spricht: "Ich war versunken in die Betrachtung des schlafenden, ganz dicht bei mir sitzenden Wesens, dem der Kopf auf die Brust fiel. Schaute auf das wirre Haar, den geschwungenen, schlanken Nacken, der elegant im Schatten der Haarspitzen lag." So liest sich das auf Deutsch, in Worten, die der Übersetzerin Alexandra Baisch eingefallen sind. Das "schlafende, ganz dicht bei mir sitzende Wesen" braucht in der Ursprache dieses Seufzers, bei der Verfasserin Anne Garréta, ein Komma mehr: "cet être endormi là, tout près, assis", und in Emma Ramadans englischer Übersetzung liest man's als "this being, asleep, so close, seated". Wer Liebe zur Sprache bringen will, braucht Einzelheiten, die sich beschreiben lassen, Merkmale, Anzeichen.
Menschen, die im Weltraum ihre Fahrzeuge verlassen haben, berichten von Lichtblitzen im Blickfeld; das sind hochenergetische Elementarteilchen, von intensiver Sonnenaktivität fortgeschleudert und auf die Netzhaut geworfen, die wir auf der Erde nicht zu sehen bekommen. Liebe ist auch eine Sonne, groß, heiß, gefährlich; ein Text kann eine Netzhaut sein, wo Einzelbeobachtungsteilchen Funken schlagen; das Wort kann nicht von ihnen absehen. Aber an A***, die Person, die in der soeben dreisprachig zitierten Erzählung "Sphinx" von einer anderen Person namens "ich" geliebt wird, gleiten gewisse Fragen nach Einzelheiten ab - sie hat nämlich kein grammatisches Geschlecht und damit für die Dauer der Erzählzeit weder ein soziales noch ein biologisches, also auch nichts, was mit dem Schubladenbegriff der "sexuellen Orientierung" etikettiert werden könnte.
Wir erfahren durchaus einiges über A*** und "ich", vom Altersunterschied etwa, vom Herkunftsunterschied (Amerika und Frankreich sind die Hintergründe), vom Beruf (A*** tanzt), auch Ethnisches. Aber alle diese Attribute beider wirken schattenhaft, unzuverlässig, wie angeknabbert von der Auslassung der Geschlechterzuordnung.
Manches, das gesagt wird, lässt zwar vermuten, dass es sich um eine Geschichte zwischen zwei Frauen handeln könnte, aber diese Menschen "lesbisch" zu nennen wäre, weil ihre Passion auf sprachlich so rigoros durchkomponierte Weise zugleich beredt und verschwiegen ist, etwa so sinnvoll, wie wenn man einen Propheten als "religiös" bezeichnen würde. Die Adjektive sind in beiden Fällen zu klein und verraten nur etwas, das allenfalls Unbeteiligte interessieren könnte.
"Sphinx" lässt alles weg, was Unbeteiligte interessieren könnte, nicht nur das grammatische Geschlecht. "Sphinx" lässt in gewisser, geradezu dämonisch-tragisch überwältigende Weise am Ende vielleicht sogar die Liebenden weg, von denen im Text nur die Liebe bleibt.
Anne Garréta, die Verfasserin dieses Textes, ist eine Oulipienne, das heißt: weibliche Kunstschaffende im Kollektiv Oulipo, dem "Ouvroir de Littérature potentielle" oder "Arbeitskreis möglicher Literatur". Dieser Zusammenhang hat sich aus einem Treffen von zehn Dichtern, Mathematikern und anderen Gelehrten entwickelt, zusammengerufen von Raymond Queneau und François Le Lionnais am 24. November 1960. Man unterhielt sich damals über die Aussicht auf eine radikale Modularisierung literarischer Ästhetik, über ludische, aleatorische und anderweitig regulierende Verfahren. Die Oulipiens (und die Oulipiennes) wussten und wissen nämlich, dass die Freiheit der Kunst nichts mit Willkür zu tun haben will, sondern sich schon immer von Bestimmungen (etwa solchen des Genres, des Versmaßes et cetera) abstoßen musste, um zu sich selbst zu kommen, dass sie solche Bestimmungen also braucht: genau wie Liebe und Leidenschaften nicht das Gegenteil von Zwängen sind (was nur Hippies glauben), sondern mit Zwängen innen und außen ringen wollen, zwischen den Polen rauschhafter Kapitulation und verzweifelter Überwindung. Eine Geschichte mit glücklichem Ausgang verspricht so etwas kaum, und deshalb ist auch "Sphinx" keine, wenn man denn unter Glück die angedrehte Harmonisierung aller Widersprüche versteht. Die Liebe liebt ihre Widersprüche, in "Sphinx" sprechen sie von sich mit mehr Namen als in Liebesgeschichten sonst (zum Beispiel, als Ort zum Tanzen, "Eden").
Was "Sphinx" mit der oulipotischen Aussparung des Geschlechts in die Liebesliteratur einführt, ist ein Zwang, der etwas freisetzt, liebesgemäß, liebesgerecht und liebesausgeliefert; halbwegs ebenbürtig bei dieser formalen Durchdringung des unsagbaren Gegenstands ist dem dreißig Jahre alten Buch heute höchstens das musikalische und konzeptkünstlerische Werk von Terre Thaemlitz - beide wissen mehr über das Menschenunmögliche der Lüste als die gesamte bemühte Kommunikation in den Netzen, Talkshows und Unis der Stunde. Sehr gut also, dass "Sphinx" nun auf Deutsch vorliegt, mit einem klugen Nachwort von Antje Rávic Strubel als Angebot ans Erleben wie ans Verstehen. "Verstehen" heißt hier freilich mehr und Besseres als Durchblick oder Überblick: Es bedeutet, sich zu verwandeln, indem man freiwillig dem fremden Sinn einer nirgends ganz durchsichtigen Liebe in die Falle geht. Der Gewinn dabei heißt Selbsterkenntnis - was wir so verstehen und was nicht, sagt uns, was Liebe von unserer Sprache überhaupt erwarten darf.
Anne Garréta: "Sphinx". Roman.
Aus dem Französischen von Alexandra Baisch. Mit einem Nachwort von Antje Rávic Strubel. Edition Fünf, Gräfelfing 2016. 184 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main